|
Andere über uns
|
Impressum |
Mediadaten
|
Anzeige |
|||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||
|
Jazz aus der Tube Bücher, CDs, DVDs & Links Schiffsmeldungen & Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Weitere Sachgebiete Tonträger, SF & Fantasy, Autoren Verlage Glanz & Elend empfiehlt: 20 Bücher mit Qualitätsgarantie Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Berserker und Verschwender Berserker und VerschwenderHonoré de Balzac Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |
Solingen: Gesenkschmiede
Hendrichs (Schleiferei).
Die
Kulturabteilung der Schwesterorganisation des LVR, des Landschaftsverbands
Westfalen-Lippe, unterhält die »Industriemuseen« im östlichen
Nordrhein-Westfalen: drei die Geschichte des Ruhrbergbaus markierende Zechen,
die Hattinger Henrichshütte, eine Ziegelei und eine Glashütte in Ostwestfalen
sowie das Schiffshebewerk Henrichenburg. Die Präsentation der Objekte ist alphabetisch angeordnet: von Aachen mit seinen Bauten der niedergegangenen Textilindustrie, über das Mindener Wasserstraßenkreuz bis hin zur Wuppertaler Schwebebahn.
Essen: Villa Hügel (Südfassade). Florian Monheim Man sieht: Das Verständnis von »Industriekultur«, wie es diesem Buch und auch dem üblichen Begriffsgebrauch zugrunde liegt, ist recht breit angelegt, wobei mit den Autoren zu erwägen ist, ob nicht der ökonomisch erzwungene »Strukturwandel« besonders im nordrhein-westfälischen Industriegebiet, vulgo »Kohlenpott«, der eigentliche Impulsgeber dafür war, aus der Not des Verlustes und des Bewahrenwollens die Tugend der »Kultur« zu machen. So gesehen, ist »Kultur« auch dort ein Synonym »für alles, was man hat, ohne es loswerden zu können« (Konrad Paul Liessmann). In ihrem einführenden Essay schreiben Eckhard Bolenz und Markus Krause mit Blick auf die Verabschiedung des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes (1980): »Erhaltung und Konservierung waren [...] auch als ein kulturpolitisches Mittel zu sehen, Entfremdungsprozesse abzumildern.« Folglich galt es, das, was man nicht loswerden konnte oder wollte, irgendwie zu bewahren; am schönsten und besten, indem man es in »Kultur« transformierte. Der vorliegende Band ist Dokument und zugleich Agens dieses Transformationsprozesses, indem er – Monheims kongeniale Photographien machen drei Viertel des Seitenvolumens aus – das gegenwärtige Zwischenleben der denkmalgeschützten Objekte: noch nicht ganz Vergangenheit und noch nicht ganz museale Zukunft, ästhetisiert und damit ihre Kulturwürdigkeit lanciert. Die Begleittexte bieten dabei wesentlich mehr als pure Gegenstandsbeschreibungen: Zwar lassen sie sich jeweils separat und parallel zum jeweiligen Bild lesen, doch entsteht am Ende ein beeindruckend belehrendes Panorama, das Industrie- und Technikgeschichte, Architektur- und Verkehrsgeschichte sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte zusammenfügt.
Oberhausen: Gasometer (Zylinder des Innenraums mit künstlerischer
Lichtinstallation). Foto: Florian Monheim
Duisburg: Landschaftspark Duisburg-Nord (Hochöfen mit Windenhäusern und
Gichtgasleitungen). Foto: Florian Monheim Seit Baudelaire definiert sich die Kunst der Moderne »durch Mimesis ans Verhärtete und Entfremdete« (Adorno). Von diesem mimetischen Impuls, der das Mechanische, Mortifizierte und Mortifizierende mit der Kamera ästhetisiert, war beispielsweise die Industriephotographie des Ehepaars Bernd und Hilla Becher getragen. Auch für den Photographen Horst Lang repräsentierte die »Industrielandschaft [...] jene andere Schönheit«, (so Andreas Rossmann in der Einleitung zu »... als der Pott noch kochte«). Wenn nun das hier besprochene Buch diese Formulierung als Titel übernimmt, evoziert es damit seinerseits unterschwellig einen Bezug zur sachlichen Foto-Ästhetik der industriellen Moderne. Besieht man sich aber Monheims Photographien, so liegt bereits auf den ersten Blick nichts ferner als die Wahrnehmung, hier werde Lebloses mit kalter Distanz stilisiert. Im Gegenteil: Eine Metaphysik des Entfremdeten ist diesen Bildern nicht zu entnehmen. Zwar entsubjektiviert auch Monheim seinen Blick; doch individualisiert er die Objekte und verleiht ihnen einen eigenen Charme: den Charme des geretteten Noch-Lebens. Mit welchen photographischen Mitteln aber erreicht es Monheim, unpersönlich und zugleich »warm« zu gestalten? Ein Unterschied zu den »kalten« Photographien etwa der Bechers springt sogleich ins Auge: der, daß Monheim in Farbe arbeitet. »Alles Lebendige«, so Goethes »Farbenlehre«, »strebt zur Farbe.« Charakteristisch ist das reiche und fließende Sonnenlicht, das bei Außenaufnahmen Schatten zeichnet und tages- oder jahreszeitliche Konturen verleiht. Wasserspiegelungen oder Winterschnee und das immer wieder in das Bild hineinwachsende Grün verweigern sich jeder Ideologie asketischer Naturverweigerung. Manchmal ist das weißbewölkte Himmelsblau geradezu postkartentauglich. Ein weiteres Indiz völlig undogmatisch-professionellen Umgangs mit der Kamera ist die Vielfalt der Perspektivenwahl: Kaum einmal werden die Monumente frontalansichtig zu statuarischen Monolithen. Indes zeichnen sich Monheims Bilder doch durch die frappante Abwesenheit von Menschen und menschlichem Treiben aus. (Geduld, sagt er, sei vonnöten gewesen, um diese seltenen Augenblicke zu erwischen. Manchmal habe er allerdings auch mit einem rot-weißes Plastikband absperren müssen.) Und so scheinen die abgelichteten Industriedenkmäler wie herausgehoben aus ihrer funktionalen Bedingtheit und werden autonomisiert, gleichsam zu Objekten eigenen Rechts. Wenn man nun die modernistische Industriephotographie – von der »Neuen Sachlichkeit« (z.B. Renger-Patzsch‘) bis zu den »Typologien« der Bechers – als »Mimesis ans Entfremdete«, wie oben gesagt, versteht, dann könnte man vielleicht in Monheims Arbeiten die Mimesis an das denkmalschützerische – paradoxe – Programm erkennen, qua Bewahrung der baulichen Relikte eines entfremdeten Zustands die drohende Gefahr neuerlicher, postindustrieller Entfremdung zu bannen. Heimat soll wieder werden, was jüngst noch, vielleicht doch, Heimat war. Währenddessen quittieren die Beschäftigten der Solinger Gesenkschmiede Hendrichs (seit 1986 LVR-Industriemuseum) die Kulturifizierung ihres Betriebs mit pathoslosem Fatalismus: »Gestern stellten wir noch Werkzeuge her, heute produzieren wir Exponate.« Wie virulent das Thema Strukturwandel und Photographie im Kulturhauptstadt-Jahr ist, erweisen die beiden Parallel-Ausstellungen (27.9.2010-16.2.2011) im Essener Ruhr Museum, das seit neuestem – ein idealtypischer Fall kulturifizierender »Umnutzung« – in der Kohlenwäsche »auf Zollverein« untergebracht ist.
Ehemalige Krupp-Rennanlage, Essen 1991 (Detail).
»Baracken«
für Kohle-Transportbänder. Foto: Heinrich Hauser, Im Kapitel »Städte« notierte Heinrich Hauser damals: »Der stärkste Eindruck, den ein Besucher empfängt, der die Städte des Reviers 1919 gekannt hat und sie 1929 wiedersieht, ist nicht der Zuwachs an Grundfläche und Bevölkerung, sondern der innere Ausbau, die Verschönerung des Stadtbildes, die Verbesserung der Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, die Entwicklung zur Zivilisation. Tatsächlich haben viele Städte in diesem Jahrzehnt ihren Kolonialcharakter so weit eingebüßt, daß man sie kaum wiedererkennt. Der Geist dieser Entwicklung wird besonders deutlich, wenn man bemerkt, daß keine Stadt sich selbst als Reinprodukt der Industrie erkennt, sondern immer als ‚Industrie- und Gartenstadt‘, als ‚Industriestadt im Grünen‘, als ‚kultureller Mittelpunkt‘.« »Kultur durch Wandel, Wandel durch Kultur« lautet das Motto, mit dem sich Essen neben Pécz (Ungarn) und Istanbul zur Kulturhauptstadt Europas 2010 qualifizieren konnte: »RUHR. 2010, Essen für das Ruhrgebiet«! »Kultur«: ein vieldeutiger, ebenso dehnbarer wie prätentiöser Begriff, der sich, wie gesehen, heutzutage sowohl auf eine zum Museum gewordene Gesenkschmiede und einen in Funktion befindlichen Hauptbahnhof als auch auf einen zum Erlebnispark umgewandelten Industriebetrieb applizieren läßt. Angesichts dieses Wucherns von »Kultur«, empfiehlt es sich vielleicht doch, mit Kants »Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht« mäßigende Besinnung anzuraten: »Wir sind im hohen Grade durch Kunst und Wissenschaft kultiviert. Wir sind zivilisiert, bis zum Überlästigen, zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber, uns für schon moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel.«
|
Eckhard Bolenz und Markus Krause (Text), Florian Monheim (Fotos):
Sigrid Schneider (Hrsg.):
Heinrich Hauser:
|
||
|
|
||||

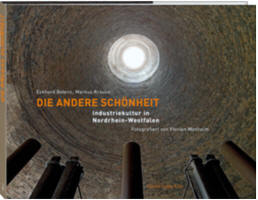
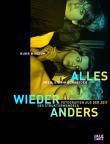




 Grundsätzlich
sieht, sofern wir Bolenz/Krause folgen, das nordrhein-westfälische
Denkmalschutzkonzept vor, bewahrenswerte Industriebauten entweder in ihrer alten
Funktion zu erhalten oder aber sie neuer Nutzung zuzuführen. Diese Neunutzung
geschieht entweder durch Musealisierung (sei es durch Bestandspflege, sei es
durch Fortführung als »Schaubetrieb«) oder durch komplette Umnutzung, wie sie
prominenterweise mit dem Gasometer in Oberhausen geschehen ist. Inzwischen ist
der Gasometer ein vielbesuchter Veranstaltungsort für »Events« aller Art:
Ausstellungen, Theateraufführungen, Konzerte etc.
Grundsätzlich
sieht, sofern wir Bolenz/Krause folgen, das nordrhein-westfälische
Denkmalschutzkonzept vor, bewahrenswerte Industriebauten entweder in ihrer alten
Funktion zu erhalten oder aber sie neuer Nutzung zuzuführen. Diese Neunutzung
geschieht entweder durch Musealisierung (sei es durch Bestandspflege, sei es
durch Fortführung als »Schaubetrieb«) oder durch komplette Umnutzung, wie sie
prominenterweise mit dem Gasometer in Oberhausen geschehen ist. Inzwischen ist
der Gasometer ein vielbesuchter Veranstaltungsort für »Events« aller Art:
Ausstellungen, Theateraufführungen, Konzerte etc. Ein
weiteres Beispiel für die Umnutzung ruhrgebietstypischer Industrieanlagen ist
der »Landschaftspark Duisburg-Nord«, den man der Bevölkerung zur
Freizeitgestaltung anbietet. Blickt man auf ein Foto Florian Monheims,
das zwei Hochöfen des Hüttenwerks abbildet, darf man wohl mit Bolenz und Krause
die Frage stellen: »Kann [...] ein stillgelegter Hochofen im Landschaftspark
Duisburg ‚schön‘ sein?«
Ein
weiteres Beispiel für die Umnutzung ruhrgebietstypischer Industrieanlagen ist
der »Landschaftspark Duisburg-Nord«, den man der Bevölkerung zur
Freizeitgestaltung anbietet. Blickt man auf ein Foto Florian Monheims,
das zwei Hochöfen des Hüttenwerks abbildet, darf man wohl mit Bolenz und Krause
die Frage stellen: »Kann [...] ein stillgelegter Hochofen im Landschaftspark
Duisburg ‚schön‘ sein?« Der
bei Hatje Cantz erschienene Katalog zur Ausstellung »Alles wieder anders.
Fotografien aus der Zeit des Strukturwandels« bringt weit über 400 Fotos von
etwa 60 Photographen und speist sich dabei weitestgehend aus dem umfänglichen
museumseigenen Fotoarchiv. Er ist thematisch (z.B. »Wohnen«, »Arbeit«, »Konsum«)
in dreizehn Rubriken unterteilt. Die weitaus größte Anzahl der Fotos ist
schwarzweiß und stammt aus den 1970/80er Jahren, der Zeit des Niedergangs der
Montanindustrie. Bilder aus den 1990ern finden sich erstens – kaum überraschend
– gehäuft im Kapitel über »Industriekultur« und zweitens in dem mit »Emscher«
übertitelten. Die Renaturierung dieses alten Flüßchens, das zur einbetonierten
Kloake gemacht worden war, hat für die Region nicht nur einen enorm
pragmatischen, sondern auch einen eminent symbolischen Wert. Und sinnigerweise
wird der Betrachter unter der Überschrift »Landschaft« dessen ansichtig, was
bleibt, wenn sich keine (denkmal)schützende Hand der nutzlos dastehenden
Industrieanlagen erbarmt: verödetes Brachland und sich selbst verschrottendes
Elend.
Der
bei Hatje Cantz erschienene Katalog zur Ausstellung »Alles wieder anders.
Fotografien aus der Zeit des Strukturwandels« bringt weit über 400 Fotos von
etwa 60 Photographen und speist sich dabei weitestgehend aus dem umfänglichen
museumseigenen Fotoarchiv. Er ist thematisch (z.B. »Wohnen«, »Arbeit«, »Konsum«)
in dreizehn Rubriken unterteilt. Die weitaus größte Anzahl der Fotos ist
schwarzweiß und stammt aus den 1970/80er Jahren, der Zeit des Niedergangs der
Montanindustrie. Bilder aus den 1990ern finden sich erstens – kaum überraschend
– gehäuft im Kapitel über »Industriekultur« und zweitens in dem mit »Emscher«
übertitelten. Die Renaturierung dieses alten Flüßchens, das zur einbetonierten
Kloake gemacht worden war, hat für die Region nicht nur einen enorm
pragmatischen, sondern auch einen eminent symbolischen Wert. Und sinnigerweise
wird der Betrachter unter der Überschrift »Landschaft« dessen ansichtig, was
bleibt, wenn sich keine (denkmal)schützende Hand der nutzlos dastehenden
Industrieanlagen erbarmt: verödetes Brachland und sich selbst verschrottendes
Elend.