|
Glanz@Elend |
Lexika
-Literaturwissenschaft |
|
|
|
Preisrätsel Verlage A-Z Medien & Literatur Museen & Kunst Mediadaten Impressum |
|||
|
Ressorts |
|||
|
|
Werkzeugkisten für Leser Eine Sichtung von Bernd Blaschke Lesen lernt man in der Schule. Wer nicht warten kann oder überehrgeizige Eltern hat, vielleicht auch schon zuvor. Das Lesen literarischer Texte lernt man am besten beim Lesen literarischer Texte. Literarische Kennerschaft erwirbt sich durch umfangreiche, gründliche Lektüren. Freilich haben sich im Laufe unserer, grob gerechnet, 3000jährigen Literaturgeschichte so einige Leser und Autoren beim Lesen und Schreiben ihre Gedanken gemacht und ihre Lektüreeindrücke und Schreibverfahren gelegentlich auch zu systematisieren versucht. So kamen Kategorien und Begriffe, Epochen und Theorien zum Beschreiben und Ordnen der Literatur in die Welt. Und diese Konzepte für Formen des Schreibens, des Verstehens, des Wertens und Historisierens wirkten wiederum zurück auf die Produzenten neuer Literatur. Es müssen ja gar nicht erst die gelehrten Gedichte Durs Grünbeins, die akademisch versierten Pop(theorie)romane Thomas Meineckes oder das essayistische Diskurstheaters René Polleschs sein, die den Leser oder Zuschauer zu einem helfenden Lexikon oder Glossar greifen lassen. Auch und gerade Formen vermeintlicher ästhetischer Unmittelbarkeit wie die Popliteratur, die Pornographie oder die Undergroundliteratur haben eine Geschichte. Genaugenommen haben diese Genres, die allesamt in den neueren Nachschlagewerken erläutert werden, nicht nur einfach einen geschichtlichen Horizont. Das überaus gründliche ‚Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft’, dessen von 1997-2003 entstandene Neubearbeitung gewissermaßen als die Mutter aller neueren deutschsprachigen Nachschlagewerke zur Literatur gelten darf, unterteilt jeden seiner von ausgewiesenen Kennern verfaßten Artikel in die Explikation des Begriffs (also das definitorische Geschäft im engeren Sinne), in die Wort- und Begriffsgeschichte (also die Herkunft, Entwicklung und Begriffsverschiebung etwa der Wörter ‚Literatur’ oder ‚Pornographie’ von ihren Anfängen bis in die Gegenwart), sodann in den historischen Zentralabschnitt der Sachgeschichte (mithin die Entwicklung dessen, was mit ‚Literatur’ oder ‚Pornographie’ bezeichnet wurde und wird) und schließlich in die Forschungsgeschichte (also die Hauptzüge des systematischen Nachdenkens über die literarische Sache, das durchaus, wie etwa im Falle der Pornographie sehr viel später und marginaler stattgefunden haben kann, als es Alter und Umfang der Sache erwarten lassen).
Die im ‚Metzler Lexikon Literatur’ noch nicht verzeichneten interdisziplinären, kulturwissenschaftlichen Forschungsfelder wie ‚Bildwissenschaften’ und der zugehörige ‚Iconic Turn’ finden sich im neuen Nünning ebenso wie ‚Raumkonzepte’ und der ‚Spatial Turn’. Die gesammelten Neueinträge dieser 4. Auflage lassen sich lesen und bestaunen wie ein Defilée neuester Theoriekreationen. Dieses Lexikon zur Literatur- und Kulturtheorie ist im übrigen kein reines Sachlexikon, da sich hier auch Artikel zu den wichtigen Theoretikerpersönlichkeiten finden. Anders als in den anderen hier angezeigten Lexika muß man also nicht schon wissen, daß man unter Dekonstruktion nachsehen muß um Konzepte Derridas zu finden oder unter Hermeneutik um auf Gadamer zu stoßen. Im ‚Nünning’ gibt es Personeneinträge neben den in der Regel sehr kenntnisreichen und ausgewogenen formulierten Sacheinträgen. Zu den Neueingängen bei den Personen zählen Giorgio Agamben, Guy Debord, Jan und Aleida Assmann und Michel de Certeau. Das zurecht vielgelobte und vielgekaufte Theorielexikon, das Anfängern wie Fortgeschrittenen erlaubt, in den weiten und gelegentlich struppigen Feldern der Theorien Orientierung und Überblick zu gewinnen, weist in seinem Anwuchs auf nunmehr 800 Seiten neben bewährten und neuen Glanzlichtern doch auch einige kleine Fehler oder Fragwürdigkeiten auf. Nicht recht einzusehen ist beispielsweise, warum es für unmittelbar zusammenhängende (oder gar deckungsgleiche) Theoriebereiche zwei Einträge gibt, die dann eben recht pleonastisch ausfallen. Dies gilt etwa für ‚Dekonstruktion’ plus ‚Dekonstruktivismus’ (wo doch die hyperkritisch undogmatische Denkbewegung der Dekonstruktion gerade kein ‚Ismus’ sein will und kann) oder für die beiden Lemmata ‚Trauma und Literatur’ sowie ‚Trauma und Traumatheorien’, wo man sich fragt, ob hier die ironische Inszenierung eines traumaspezifischen Wiederholungszwanges am Werk ist, wenn die ersten 20 Zeilen des ersten Eintrags wörtlich im zweiten wiederkehren. Der Eintrag zum ‚Ereignis’ ist von Nünning nur als erzähltheoretischer Begriff erläutert, während im ‚Metzler Literatur Lexikon’ zurecht auf den emphatischen, geschichtsphilosophischen Ereignis-Begriff hingewiesen wird, der aus Heideggers Spätwerk kommend auf Derridas und Agambens Zeit-Philosophie aber auch auf Ästhetiker wie Gumbrecht, Mersch und Seel wirkte. Der Begriffseintrag (ohne eigenen Artikel) ‚Environmental Criticism’ verweist im neuen ‚Nünning’ fälschlich auf den Eintrag ‚New Economic Criticism’, wo es jedoch nicht um ökologisch orientierte Literaturwissenschaft geht – der Link müßte richtig auf den informativen Eintrag zu ‚Ecocriticism/Ökokritik’ verweisen. Doch mindern diese kleinen Schwächen den großen Nutzen des ‚Lexikon Literatur- und Kulturtheorie’ nur unwesentlich. Es gibt weiterhin keinen besseren handlichen Kompaß durch die fruchtbar blühende, wachsende und gelegentlich wuchernde Theorielandschaft der Kulturwissenschaften als dieses leuchtend gelb eingebundene Lexikon.
Eine gewisse Desorientierung und einige Überschneidungen produziert freilich die Hauptgliederung der drei Bände. So treten etwa die Bezüge der Literatur zur Musik (oder zur Philosophie oder bildenden Kunst) einmal im ersten Band auf unter der Rubrik ‚Kontexte’ und ein weiteres Mal im zweiten Band unter dem Aspekt ‚Literaturwissenschaft und ihre Nachbarwissenschaften’. Verdeutlichen wir an einem Beispiel einige der Vorzüge und Fallstricke des neuen Handbuchs und seiner Konkurrenten. Wer sich etwa zu dem für die neueren Theaterdiskussionen zentralen Konzept des ‚postdramatischen Theaters’ informieren möchte, findet direkt dazu im ‚Lexikon Theatertheorie’ (wiederum vom unvermeidlichen Metzler Verlag publiziert) einen umfangreichen und informativen Artikel. Im Handbuch von Anz findet sich der Begriff im Register nachgewiesen für den Schluß des Eintrags zum Theater im ersten Band, wo Erhellendes zum zunehmend divergenten Verhältnis von Literatur und Theater in der Gegenwart formuliert wird. Ferner finden sich im zweiten Band unter dem Stichwort ‚Theaterwissenschaft’ erneut viele Überlegungen zum Status von Drama und Dramaturgie und zur performativen Wende der Theaterwissenschaft, doch wird hier der so wichtige und naheliegende Begriff des postdramatischen Theaters weder verwendet noch gar expliziert. Man muß sich erst gewöhnen an die Doppelstruktur des Anz-Handbuchs aus Grundbegriffen (bei denen unter ‚Institutionen der Literaturvermittlung’ auch der zwanzigseitige Beitrag zum Theater steht) und den im zweiten Band folgenden ‚Methoden und Theorien’, wo dann die Entwicklungen der Theaterwissenschaft skizziert werden. Das ‚Metzler Lexikon Literatur’ führt übrigens keinen Eintrag zum postdramatischen Theater, erwähnt diesen Begriff nur kurz im Artikel zum ‚Drama’ (nicht aber im Eintrag zu ‚Theater’). Nünnings Theorielexikon expliziert den besonders durch Hans-Thies Lehmann elaborierten Begriff knapp in den Einträgen zu ‚Theater und Literatur’ und ‚Theatertext’, erwähnt hingegen im langen Artikel zu Dramentheorien den postdramatischen Wandel der zeitgenössischen Theaterpraxis nicht. Angesichts solcher gelegentlichen Probleme auf der Suche nach einem (mittlerweile doch recht prominenten) Begriff und seiner Explikation sehnt man sich beim Blättern in den – allesamt recht ansehnlich wenn auch in keinem Fall herausragend elegant gestalteten – Lexikonbüchern ein wenig nach der schnellen Volltextsuche und Begriffsauffindung, die das Internet ermöglicht. Doch gibt es eben im Netz noch keine literaturwissenschaftlichen Sachwörterbücher vergleichbarer Güte! Auch das große Reallexikon verzeichnet den Begriff postdramatisches Theater (verständlicherweise) noch nicht: weder in den Artikeln zum Drama noch in denen zum Theater und der Theaterwissenschaft gibt es Hinweise auf Begriff und Sache. Zwar finden sich hier Bemerkungen zur neueren Fokussierung des Theaters und seiner Erforschung auf Theatralität und Performance anstelle der vormaligen Orientierung an Text und Drama; doch erschien das Reallexikon zu früh (von 1997-2003) um den 1999 in Lehmanns Monographie popularisierten Begriff noch aufzunehmen. Ein guter Handbuch-Artikel erspart einem bekanntlich die Lektüre vieler, gelegentlich allzu punktueller oder gar diffuser Sekundärliteratur. Im Anzschen Handbuch finden sich neben den gelehrten Ausführungen zu nahezu allen Aspekten der Literatur, ihrer Wissenschaft und ihrer Grenzgebiete im übrigen auch nützliche kleine Beiträge, die das Handwerk des Recherchieren, Schreibens und Publizieren betreffen. Hier werden, am Ende des dritten Bandes, nicht nur sachdienliche Hinweise zum Aufbau der Gattungen ‚Monographie’ oder ‚Rezension’ geboten. Auch die Vorschule des wissenschaftlichen Schreibens, das Verfassen von Seminar- und Abschlußarbeiten wird didaktisch und anschaulich vom Herausgeber Anz persönlich erklärt. Überhaupt besticht das neue Handbuch Literaturwissenschaft durch das Vermögen, Wissen und Wissenschaft so klar wie irgend möglich aufzubereiten und zu formulieren. Dies ist gelungene Wissensvermittlung ohne jeden Wissensdünkel. Fazit unseres Stöberns in den neuesten Fachlexika- und Handbüchern der Literatur: Für Fachleute bleibt das Reallexikon mit seinen großen Einträgen die breite Basis oder letzte Instanz unter allen Sachwörterbüchern, auch wenn dessen letzte Bearbeitung schon wieder 5-11 Jahre alt ist und folglich neueste Trends nicht mehr verzeichnen konnte. Das ebenfalls nicht ganz billige Anz-Handbuch bietet im Vergleich zu den genrebedingt knapperen Lexikonbeiträgen etwas ausführlichere, in größeren Zusammenhängen aufbereitete Informationen zu Grundbegriffen, Institutionen, Theorieschulen, Grenzgebieten und Arbeitsfeldern der Literaturwissenschaft. Es ist mit seinen Beiträgen etwa zu Intermedialität oder Hypertextualität, zu ‚Literatur und Naturwissenschaften’ oder zu audiovisuellen Medien auf dem neusten Stand der medialen und epistemischen Rahmungen der altehrwürdigen Literatur und ihrer Erforschung. Der ‚Nünning’ bleibt für philosophisch interessierte Theorieliebhaber und Studierende, die sich einen Überblick im Theoriedschungel verschaffen wollen, das unverzichtbare, ständig überarbeitete Handbuch. Das neue einbändige Metzler-Lexikon Literatur bietet nicht nur die größte Zahl der Einträge und zweifellos das meiste Wissen fürs Geld, es überzeugt auch (auf den Schultern von Riesen, mithin des Reallexikons und des Nünning stehend) durch nahezu ausnahmslos erstaunlich kompakte wie kompetente Artikel. Dem in der Produktion von geisteswissenschaftlichen Fachlexika recht treffsicheren Metzler Verlag ist hier ein weiteres Glanzstück gelungen, dass man in die Bibliothek eines jeden leidenschaftlichen Lesers und jedes Literaturstudierenden empfehlen kann. Viele Publikationen des Metzler Verlags (und ebenso die bezahlbare Neuauflage von de Gruyters Reallexikon) dürfen als weit bedeutsamere Beiträge zu den Geisteswissenschaften gelten als so manche Aktion oder Plauderstunde zum vergangenen Jahr der Geisteswissenschaften. Diese aktuellen Lexik und Handbücher dienen als nützliche Werkzeugkisten für Leser und Literaturwissenschaftler. Das Schmökern oder gezielte Nachschlagen in diesen Referenzwerken macht klug und inspiriert für neue Lektüren. Wer diese kondensierten Kompendien zum Stand kulturwissenschaftlichen Wissens, Diskutierens und Forschens in den Händen hält, dem braucht um die Zunft und Zukunft der Geisteswissenschaften nicht bange zu sein. Auf diese Steinen können Sie bauen. Das begriffliche und historische Wissen, das hier – meist in weitgehend allgemeinverständlicher Form – versammelt vorliegt, bietet eine solide Grundlage für Lektüren und Studien im grenzenlosen Reich der Literatur. Kein
Lexikon wird die Leseerfahrungen, die man mit Gedichten, Theatertexten
Erzählungen oder Romanen macht, ersetzen können. Ein reflektierter und
historisch informierter Rahmen an Begriffen und Kenntnissen kann aber manches
Buch noch besser erschließen und manchen Gedankenflug auslösen oder absichern.
Insofern bereichern diese scheinbar so trockenen Handbücher unsere Lesefähigkeit
und die Lust an der Literatur wie am gebildeten Gespräch über sie. Wenn, mit
Kant gesprochen, Begriffe ohne Anschauung leer bleiben und Anschauungen ohne
Begriffe blind, dann kann die abwechselnde, sich ergänzende und befruchtende
Lektüre von (guten) Lexika oder Forschungstexten und von literarischen Werken
als Königsweg zum aufgeklärten, aufmerksam sensiblen Lesen gelten. Und womöglich
sind solch gebildete, sensible und verständnisfähige Leser schließlich doch die
sympathischeren Menschen.
Bernd
Blaschke |
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft
Dieter Burdorf/Christoph
Fasbender/Burkhard Moennighoff (Hrsg.) |
|
|
Glanz@Elend
|
|||


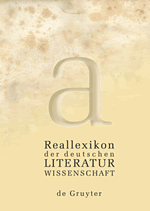 Dieses
hochgelehrte Reallexikon liegt nun seit 2007 endlich auch in einem für breitere
Schichten erschwinglichen Paperback-Nachdruck vor. Das von Klaus Weimar, Harald
Fricke, Jan-Dirk Müller im Verbund mit weiteren Germanistikprofessoren
herausgegebene Lexikon ist ein wahres Füllhorn an begriffsgeschichtlichen
Erkenntnissen und ein, in drei prallen Bänden, immer noch recht umfangreiches
Kompendium des Wissens über die Geschichte der Literaturwissenschaft und der sie
begleitenden Diskurse. Das ‚Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft’
selbst geht auf das 1925-1931 erstmals erschienene ‚Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte’ zurück, dessen zweite Auflage von 1958-1977 erschien. Es
steht also auf der Schulter von Riesen, deren solide gelehrte Statur man auch an
der langen Bearbeitungsdauer ablesen kann. Auch die drei Bände des (nun auch
schon nicht mehr ganz) ‚neuen’ Reallexikons wurden in gewiß nicht weniger als
zehnjähriger Kollektivforschung erstellt. In den Zeiten recht schnellebiger
Forschungstrends in den Kultur- und Literaturwissenschaften hält ein solch
grundsolides Werk zwar wohl nicht mehr für die Ewigkeit – wie ein Vergleich mit
den druckfrischen Nachfolge-Lexika und ihren jüngsten Begriffszugängen erweist.
Doch ist damit eine Summa vorgelegt, angesichts der die Geisteswissenschaften
durchaus stolz auf das in nunmehr etwa 200 Jahren akademischer
Literaturforschung erarbeitete Wissen blicken dürfen.
Dieses
hochgelehrte Reallexikon liegt nun seit 2007 endlich auch in einem für breitere
Schichten erschwinglichen Paperback-Nachdruck vor. Das von Klaus Weimar, Harald
Fricke, Jan-Dirk Müller im Verbund mit weiteren Germanistikprofessoren
herausgegebene Lexikon ist ein wahres Füllhorn an begriffsgeschichtlichen
Erkenntnissen und ein, in drei prallen Bänden, immer noch recht umfangreiches
Kompendium des Wissens über die Geschichte der Literaturwissenschaft und der sie
begleitenden Diskurse. Das ‚Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft’
selbst geht auf das 1925-1931 erstmals erschienene ‚Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte’ zurück, dessen zweite Auflage von 1958-1977 erschien. Es
steht also auf der Schulter von Riesen, deren solide gelehrte Statur man auch an
der langen Bearbeitungsdauer ablesen kann. Auch die drei Bände des (nun auch
schon nicht mehr ganz) ‚neuen’ Reallexikons wurden in gewiß nicht weniger als
zehnjähriger Kollektivforschung erstellt. In den Zeiten recht schnellebiger
Forschungstrends in den Kultur- und Literaturwissenschaften hält ein solch
grundsolides Werk zwar wohl nicht mehr für die Ewigkeit – wie ein Vergleich mit
den druckfrischen Nachfolge-Lexika und ihren jüngsten Begriffszugängen erweist.
Doch ist damit eine Summa vorgelegt, angesichts der die Geisteswissenschaften
durchaus stolz auf das in nunmehr etwa 200 Jahren akademischer
Literaturforschung erarbeitete Wissen blicken dürfen. Auf
den Schultern dieses Riesen (und seiner ebenso potenten Brüder, dem
‚Historischen Wörterbuch der Philosophie’ und dem noch nicht ganz beendeten
‚Historischen Wörterbuch der Rhetorik’) steht dann auch das neue, einbändige
‚Metzler Lexikon Literatur’ (herausgegeben von Dieter Burdorf, Christoph
Fasbender und Burkhard Moennighoff). Es beruht auf dem einst von Günther und
Irmgard Schweikle begründeten ‚Metzler Lexikon Literatur’ und stellt dessen 3.
Auflage dar. Diese ist deutlich erweitert – allein um 600 neue Artikel gegenüber
der 2. Auflage. Sie vermittelt nun auf 845 eng bedruckten Seiten
terminologisches und sachliches Wissen zu 4000 Stichworten. Es handelt sich
hier, wie beim Reallexikon, um ein Sachlexikon; es führt also keine Artikel zu
Personen. Die schiere Zahl seiner Einträge (die die des Reallexikons etwa um das
vierfache übersteigt), zeigt die Weite des Horizonts, zu dem nunmehr auch ein
größerer Eintrag zur (erst jüngst begrifflich neben die Weimarer Kulturblüte
getretenen) ‚Berliner Klassik’ zählt. Es umfaßt aber auch eine Vielzahl von
Stichworten zur neueren Pop- und Medienkultur. Dabei ist der Horizont des
Metzler Lexikons (im Gegensatz zum germanistisch orientierten Reallexikon) ein
europäischer: Einträge zu den größeren Fächern wie Slawistik und Romanistik
finden sich ebenso wie die Erläuterungen zu Epochen wie dem ‚silbernen
Zeitalter’ der russischen Literatur oder zu historisch-regionalen
Dichtungsformen wie der ‚Sirventes’ der altokzitanischen Trobadorlyrik oder zu
Gestalten wie dem lustigen Gracioso des spanischen Barocktheaters oder zur
französischen Lachtheater-Institution des Grand Guignol. Die Grenzen der
europäischen Literatur überschritten werden (begrüßenswerterweise), wo es um
global wirksame Phänomene geht – etwa mit Einträgen zum japanischen No-Theater
oder zur immer wichtiger werdenden Migrantenliteratur und der sie begleitenden
Theorien des Postkolonialismus.
Auf
den Schultern dieses Riesen (und seiner ebenso potenten Brüder, dem
‚Historischen Wörterbuch der Philosophie’ und dem noch nicht ganz beendeten
‚Historischen Wörterbuch der Rhetorik’) steht dann auch das neue, einbändige
‚Metzler Lexikon Literatur’ (herausgegeben von Dieter Burdorf, Christoph
Fasbender und Burkhard Moennighoff). Es beruht auf dem einst von Günther und
Irmgard Schweikle begründeten ‚Metzler Lexikon Literatur’ und stellt dessen 3.
Auflage dar. Diese ist deutlich erweitert – allein um 600 neue Artikel gegenüber
der 2. Auflage. Sie vermittelt nun auf 845 eng bedruckten Seiten
terminologisches und sachliches Wissen zu 4000 Stichworten. Es handelt sich
hier, wie beim Reallexikon, um ein Sachlexikon; es führt also keine Artikel zu
Personen. Die schiere Zahl seiner Einträge (die die des Reallexikons etwa um das
vierfache übersteigt), zeigt die Weite des Horizonts, zu dem nunmehr auch ein
größerer Eintrag zur (erst jüngst begrifflich neben die Weimarer Kulturblüte
getretenen) ‚Berliner Klassik’ zählt. Es umfaßt aber auch eine Vielzahl von
Stichworten zur neueren Pop- und Medienkultur. Dabei ist der Horizont des
Metzler Lexikons (im Gegensatz zum germanistisch orientierten Reallexikon) ein
europäischer: Einträge zu den größeren Fächern wie Slawistik und Romanistik
finden sich ebenso wie die Erläuterungen zu Epochen wie dem ‚silbernen
Zeitalter’ der russischen Literatur oder zu historisch-regionalen
Dichtungsformen wie der ‚Sirventes’ der altokzitanischen Trobadorlyrik oder zu
Gestalten wie dem lustigen Gracioso des spanischen Barocktheaters oder zur
französischen Lachtheater-Institution des Grand Guignol. Die Grenzen der
europäischen Literatur überschritten werden (begrüßenswerterweise), wo es um
global wirksame Phänomene geht – etwa mit Einträgen zum japanischen No-Theater
oder zur immer wichtiger werdenden Migrantenliteratur und der sie begleitenden
Theorien des Postkolonialismus. 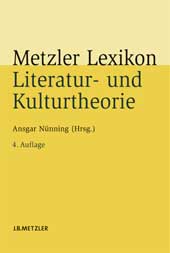 Die
Artikel dieses vielseitigen, einbändigen Lexikons sind (natürlich) nicht so
umfangreich wie die des Reallexikons und folgen auch nicht dessen strenger
Untergliederung in die vier Aspekte von der Wortexplikation bis zur
Forschungsgeschichte. Doch sind die Einträge fast durchweg gelungene,
hochverdichtete Miniaturen des literarischen und literaturtheoretischen
Sachwissens. Mediale Nachbarbereiche wie der Film und noch seine Untergattung
des Film noir werden ebenso mit größeren Einträgen gewürdigt wie Begriffe aus
der Editionswissenschaft oder der gesamteuropäischen Mediavistik. Neuere,
zeitweise umstrittene Forschungsansätze wie Dekonstruktion, Intermedialität oder
Gender Studies werden nüchtern und unaufgeregt referiert und sind, wie alle
Einträge, mit aktuellen (meist souverän zusammengestellten) Bibliographien zum
Weiterlesen versehen. Nur die allerneusten, letzten Trends des
kulturwissenschaftlichen Paradigmenkarussells haben noch nicht alle Eingang in
dieses Literaturlexikon gefunden. Dafür gibt es in dem auf
geisteswissenschaftliche Handbücher und Lexika spezialisierten Metzler Verlag
das von Ansgar Nünning herausgegebene ‚Metzler Lexikon Literatur- und
Kulturtheorie’, das soeben in einer nochmals deutlich erweiterten und
aktualisierten 4. Auflage erschienen ist.
Die
Artikel dieses vielseitigen, einbändigen Lexikons sind (natürlich) nicht so
umfangreich wie die des Reallexikons und folgen auch nicht dessen strenger
Untergliederung in die vier Aspekte von der Wortexplikation bis zur
Forschungsgeschichte. Doch sind die Einträge fast durchweg gelungene,
hochverdichtete Miniaturen des literarischen und literaturtheoretischen
Sachwissens. Mediale Nachbarbereiche wie der Film und noch seine Untergattung
des Film noir werden ebenso mit größeren Einträgen gewürdigt wie Begriffe aus
der Editionswissenschaft oder der gesamteuropäischen Mediavistik. Neuere,
zeitweise umstrittene Forschungsansätze wie Dekonstruktion, Intermedialität oder
Gender Studies werden nüchtern und unaufgeregt referiert und sind, wie alle
Einträge, mit aktuellen (meist souverän zusammengestellten) Bibliographien zum
Weiterlesen versehen. Nur die allerneusten, letzten Trends des
kulturwissenschaftlichen Paradigmenkarussells haben noch nicht alle Eingang in
dieses Literaturlexikon gefunden. Dafür gibt es in dem auf
geisteswissenschaftliche Handbücher und Lexika spezialisierten Metzler Verlag
das von Ansgar Nünning herausgegebene ‚Metzler Lexikon Literatur- und
Kulturtheorie’, das soeben in einer nochmals deutlich erweiterten und
aktualisierten 4. Auflage erschienen ist.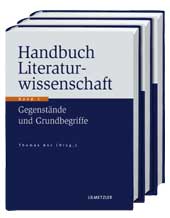 Den
Verdiensten des Metzler Verlags (der im nächsten Jahr auch eine Neuausgabe des
‚Kindler Literaturlexikons’ vorlegen wird) im Bereich der
geisteswissenschaftlichen Lexika und Handbücher wurde jüngst ein weiterer
Leuchtturm hinzugefügt mit der Publikation des von Thomas Anz herausgegebenen
dreibändigen ‚Handbuch Literaturwissenschaft’. Im Gegensatz zu den alphabetisch
nach Stichworten gegliederten Lexika handelt es sich beim Handbuch um einen
systematischen Aufriß literaturwissenschaftlichen Wissens. Nützliche Sach- und
Personenregister am Ende des dritten Bandes machen das Handbuch freilich auch
ansatzweise lexikographisch nutzbar. Thomas Anz darf seit seiner Zeit als
Literaturredakteur bei der FAZ, dann als Gründer des wohl bedeutendsten
Internet-Rezensionsmediums Literaturkritik.de und auch als Vorsitzender des
Germanistenverbandes (von 2004-2007) als einer der herausragenden Vermittler
literarischen und theoretischen Wissens gelten. Ihm ist es mit dem Handbuch
gelungen, etwa 70 Spezialisten der Literaturforschung zu versammeln, die so
kenntnisreich wie allgemeinverständlich die Fachgeschichte, Begriffe, Theorien,
Methoden, Institutionen und Berufsfelder der (deutschen) Literaturwissenschaft
zusammenfassen. Der erste Band ist den ‚Gegenständen und Grundbegriffen’
gewidmet, der zweite den ‚Methoden und Theorien’, der dritte schließlich
‚Institutionen und Praxisfeldern’. Den einzelnen Begriffen (wie etwa dem ‚Autor’
und den ihn betreffenden Forschungen, oder dem ‚Leser’, zudem auch benachbarten
Wissensfeldern wie ‚Religion’, ‚Musik’ oder ‚Philosophie’ und ferner
Institutionen wie dem ‚Theater’ oder dem ‚Buchhandel’ u.a.m.) gelten jeweils
etwa 10-30 seitige Artikel, die den begrifflichen Apparat, den Forschungsstand
und offene Fragen des Bereichs überblicksmäßig und doch oft auch an
literarischen Texten exemplifizierend darstellen. Der Abriß zur Geschichte der
Literaturwissenschaft im 3. Band, verfaßt von vier Autoren, umfaßt nahezu 200
der zweispaltig bedruckten Seiten.
Den
Verdiensten des Metzler Verlags (der im nächsten Jahr auch eine Neuausgabe des
‚Kindler Literaturlexikons’ vorlegen wird) im Bereich der
geisteswissenschaftlichen Lexika und Handbücher wurde jüngst ein weiterer
Leuchtturm hinzugefügt mit der Publikation des von Thomas Anz herausgegebenen
dreibändigen ‚Handbuch Literaturwissenschaft’. Im Gegensatz zu den alphabetisch
nach Stichworten gegliederten Lexika handelt es sich beim Handbuch um einen
systematischen Aufriß literaturwissenschaftlichen Wissens. Nützliche Sach- und
Personenregister am Ende des dritten Bandes machen das Handbuch freilich auch
ansatzweise lexikographisch nutzbar. Thomas Anz darf seit seiner Zeit als
Literaturredakteur bei der FAZ, dann als Gründer des wohl bedeutendsten
Internet-Rezensionsmediums Literaturkritik.de und auch als Vorsitzender des
Germanistenverbandes (von 2004-2007) als einer der herausragenden Vermittler
literarischen und theoretischen Wissens gelten. Ihm ist es mit dem Handbuch
gelungen, etwa 70 Spezialisten der Literaturforschung zu versammeln, die so
kenntnisreich wie allgemeinverständlich die Fachgeschichte, Begriffe, Theorien,
Methoden, Institutionen und Berufsfelder der (deutschen) Literaturwissenschaft
zusammenfassen. Der erste Band ist den ‚Gegenständen und Grundbegriffen’
gewidmet, der zweite den ‚Methoden und Theorien’, der dritte schließlich
‚Institutionen und Praxisfeldern’. Den einzelnen Begriffen (wie etwa dem ‚Autor’
und den ihn betreffenden Forschungen, oder dem ‚Leser’, zudem auch benachbarten
Wissensfeldern wie ‚Religion’, ‚Musik’ oder ‚Philosophie’ und ferner
Institutionen wie dem ‚Theater’ oder dem ‚Buchhandel’ u.a.m.) gelten jeweils
etwa 10-30 seitige Artikel, die den begrifflichen Apparat, den Forschungsstand
und offene Fragen des Bereichs überblicksmäßig und doch oft auch an
literarischen Texten exemplifizierend darstellen. Der Abriß zur Geschichte der
Literaturwissenschaft im 3. Band, verfaßt von vier Autoren, umfaßt nahezu 200
der zweispaltig bedruckten Seiten.