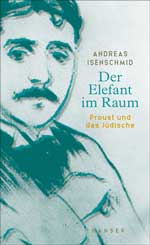|
Andreas Isenschmids
Beschäftigung mit dem Jüdischen bei Marcel Proust (1871-1922) beginnt mit der
Dreyfus-Affäre und dem damit zusammenhängenden modernen Antisemitismus. 1894
wurde Alfred Dreyfus als angeblicher deutscher Spion in der französischen Armee
verurteilt, am 5. 1. 1895 öffentlich degradiert und anschließend nach Guyana
verbracht. Der Skandal war eine Erweckung für den Zionisten Theodor Herzl, der
als Journalist und Beobachter am Prozess teilnahm. Einer der wenigen, die an
Dreyfus‘ Unschuld glaubten, war der junge Marcel Proust. Das Verhalten Dreyfus
gegenüber wird für Isenschmid die Hauptreferenz einer Wirklichkeit gegenüber
einer Fiktion und damit zur realistischen Nagelprobe für Prousts Schreiben. Er
greift dazu auf die Frühschriften und die Briefe, vor allem aber auf die
Varianten des Romans Jean Santeuil zurück. Es handelte sich bei der
Dreyfus-Affäre um einen Justizskandal. 1897 begann die Kampagne für die
Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Alfred Dreyfus. Émile Zola schrieb fünf
Artikel in fünf Wochen, wodurch die Sache ihre nationale Dimension bekam. Proust
ging regelmäßig zum Prozess, auch zu dem gegen Zola. Wie verhält er sich zu
diesem Skandal? Er sähe sich nicht als Jude, aber auch nicht als Nicht-Jude,
meint Isenschmid:
»Die
These dieses Buches ist es, dass Proust sowohl bei seinem politischen Aktivismus
als Dreyfusard wie beim Schreiben von starken jüdischen Gefühlen geleitet wurde,
dass er sie aber meist nur indirekt zum Ausdruck brachte und zu ihnen eine
durchgängig ambivalente Beziehung unterhielt. (S. 23)«
Proust und die jüdische Tradition
Diese Mutmaßung über die Beziehung Prousts zu seinen Gefühlen gibt das Ergebnis
des ersten von drei Kapiteln ab. In diesem Sinne kann Isenschmid im zweiten
Kapitel zeigen, dass entgegen einer katholischen Lesart nicht das väterliche
Illier-Combray mit seinen Kirchenglocken Prousts wichtigste Umgebung ausmache,
sondern dass die berühmten Gutenachtdramen in Auteuil bei Paris spielen, im
Hause der Familie der jüdischen Mutter. Im dritten Kapitel wird deutlich, dass
Charles Swann, der von Proust erdachte Held der Recherche, ein
assimilierter Jude und mit Eigenschaften seines Großvaters, seines Großonkels
und anderer ausgestattet ist und weiter, dass bei aller Ambivalenz der
Beschreibungen der jüdischen Familie der Blochs im Roman diesen seine Sympathie
gilt. Proust macht sich aber auch antisemitische Ansichten zu eigen und legt sie
in den Mund seiner Figuren.
Isenschmid befragt vor allem Proust nicht ernsthaft danach, ob er damit nicht
ausgedrückt habe, was das Jüdische sei?
Der Proustsche Maelstrom
Sich ernsthaft mit
Marcel Proust zu beschäftigen, hat es in sich. Oft teilen der Leser und die
Leserin ihre Zeit ein in eine Phase vor und nach dieser Beschäftigung. Es geht
um Kontaktmagie: zu stark ist der Sog, selbst so kleinteilig und mäandernd zu
schreiben wie der französische Ausnahmeromancier. Proust und seinen Texten
gegenüber erweisen sich die herkömmlichen Referenzen der angeblich so harten
Realität als windelweich und hinfällig: Rechtschreibregeln betrifft das
ebenfalls wie sogenannte „Lebensformen“ (wie beispielsweise Thomas Manns „Lübeck
als Lebensform“, die Isenschmid erwähnt). Eine dualistische Trennung zwischen
empirischen Marcel und dem Erzähler der Recherche, zwischen der Sphäre
der Kunst und des politischen Lebens lässt sich hier ebenso wenig
aufrechterhalten wie eine vermeintliche Härte von Fakten vor der Dekonstruktion.
Wer Proust liest, wird nach einer Phase der Abstoßung unweigerlich von diesem
affiziert und es dauert Jahre, um das eigene Schreiben von diesem Durchgang zu
emanzipieren. Das gilt für Prosa ebenso wie für Kritik und betrifft den
überbordenden Stil Prousts, von dem die Leser und die Leserin sich zunächst kaum
freimachen können. Es gilt aber auch für bestimmte Themen wie das Jüdische.
Es werde nach Isenschmid von Proust nicht direkt angesprochen und gleiche darin
– so will zumindest der Titel seines Essays nahelegen – dem sprichwörtlichen
Elefanten im Raum, den jeder kenne, über den offen zu sprechen sich aber niemand
traue. Dabei verpasst Isenschmid, worum es ihm offiziell geht: Es gibt keine
jüdische Identität oder das Jüdische, auf das man Proust festlegen könnte und zu
dem dieser sich neudeutsch bekennen sollte. Jüdisch ist, wer von einer jüdischen
Mutter geboren wird. Was sie oder er daraus macht, ist ihre oder seine Sache.
Anders gesagt, nicht allein die Position des Zentralrats der Juden ist jüdisch,
sondern auch die von Judith Butler; nicht nur eine Meinung von Theodor Herzl,
sondern auch die von Marcel Proust. Bei einem Bekenntnis zum Jüdischen, auf das
Isenschmid anscheinend aus ist, handelt sich um eine Diskursformation, die sich
erst im Zuge der rassistischen Debatten des späten 19. Jahrhundert ausbildet und
in den heute wiederkehrenden vorherrschenden Zwang zu der Anerkennung einer
eigenen Identität fröhliche Umstände feiert. Für Franz Kafka beispielsweise war
die jüdische Frage eben solche, ob man sich assimilieren soll oder nicht. Ein
Bekenntnis zu einer jüdischen Identität, zum Staat Israel usw. wächst erst auf
dem Rücken des modernen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, der faschistischen
Vernichtungspolitik und des Zionismus. Auch die Unterscheidung zwischen
jüdischen und arabischen Semiten geht auf die „archäologische Politik des
Staates Groß-Israel“ (Amos Elon) und die Propaganda der Gegenseite zurück. Bei
Proust dagegen ist gerade das Faszinierende, dass die Welt zum Text wird und der
Text zur Welt. Nicht umsonst lautet eine berühmte Stelle der Recherche: „Und die
Häuser, die Straßen, die Alleen, sind flüchtig, ach! wie die Jahre.“ Wenn ein
jüdisches Dispositiv gibt, das dem Volk des Buches annähernd gerecht wird, dann
ist es dieses.
Das Jüdische bei Proust – der Gipfel der Verwirrung
Isenschmid will zeigen,
dass bei Proust ein jüdischer Zusammenhang, wenn auch verrückt und verschoben,
permanent anwesend sei. Das ist im Prinzip ein löbliches Unterfangen. In seinem
Bemühen, den literaturwissenschaftlichen Diskurs über Marcel Prousts, der mit
dem französischen Vater und dem Leben im katholischen Illier-Combray verbunden
ist, nun einen jüdischen, auf die Familie der Mutter und deren Wohnsitz in
Auteuil am Rande des Bois de Boulogne zu ersetzen, aber wird das Kind mit dem
Bade ausgeschüttet. Isenschmid will bei Proust, wenn es um das Jüdische ginge,
einen schlingernden Diskurs ausmachen. Es handle sich um eine Verwirrung des
Autors, der bei dem Thema nicht mehr wisse, wo ihm der Kopf stehe.
Proust aber schreibt über seine Verhältnisse so, wie sie sich ihm darbieten:
über die jüdischen Fragen als Bewegung zwischen Assimilation und Herkunft, als
ein Pendeln zwischen der Welt des katholischen Vaters und der der
deutsch-jüdischen Mutter ebenso wie zwischen seiner homoerotischen und
heterosexuellen Neigung und ebenso wie zwischen dem empirischen Marcel und dem
Erzähler-Ich der Romane Jean Santeuil und Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit, der Recherche. Die konstatierte Verwirrung liegt bei
Isenschmid, der ein ästhetisches Klischee bedient, wonach der Künstler nicht
wisse, was er tue. Der Autor macht etwas anderes, als der Kritiker sich gedacht
hat. Proust Form fällt aus Isenschmids Kategorien heraus. Sein Rahmen setzt die
Trennung zwischen der empirischen und der ästhetischen Welt voraus, die Proust
gerade aufheben will. Isenschmid tut so, als setzte er einen differenzierten
Diskurs an und untersucht die verschiedenen Pastiche-Ebenen, von denen aus in
einem „Fiktionsbruch“ (S. 53) das Reale ins Fiktionale hineinspräche, der
wirkliche Marcel nun der Romanfigur die Worte in den Mund legen würde. Oder das
Vorbild der Figur Charles Swann, Charles Haas, in der Romanfigur
wiederzuerkennen wäre.
All das aber macht Proust gerade nicht; er verweigert sich einem solche
Realismus als Trennung zwischen einer primären Realität des Außen und der
sekundären innerhalb des Romans. Er unterscheidet nicht zwischen dem politischen
Marcel in der Dreyfus-Affäre und dessen Verarbeitung in den Romanen. Proust
nimmt gerade die Ästhetik so ernst, dass er ihr selbst eine eigene Realität
zuspricht. Darin wird deutlich, dass das Jüdische, das Proust in seinem Roman
nach Isenschmid anscheinend verdeckt, verschoben oder entstellt zum Ausdruck
brächte, gerade diese Verschiebung darstellt.
Das Jüdische – eine Schimäre
Historisch weiß man,
dass die Idee einer jüdischen Identität so gut wie die einer anderen ethnisch,
kulturell oder rassisch begründeten eine fiktionale ist. Sie bleibt identitär
und kulturalistisch. Sie entsteht als Reversi des Ungeistes einer
Rassenidentität des sogenannten Ariernachweises. Was soll dieses Jüdische nach
Isenschmid im Letzten sein? Eine entsprechende Lesart bei Proust will er darin
sehen, dass die Existenzen von Charles Swann und der Bloch-Familie als
erzählerischer „Widerstand gegen den Tod“ im Namen erhalten bleiben.
Für Swann sieht er solchen Widerstand in dem Bemühen, dass er in seiner Tochter
Gilberte als Jude weiterleben wolle; ein Ansinnen, dem sie sich verweigert. Über
den Tod hinaus gehen zu wollen (und damit diesem Widerstand zu leisten), ist
aber kein Kennzeichen eines Jüdischen, auch nicht in der Ästhetik. Ursprünglich
kennt das Judentum kein Weiterleben nach dem Tod. Das kommt erst in der
Konkurrenz mit dem Christentum auf. Wir finden diese Idee dann in dem
christlichen Wunsch bei Augustinus‘, nach der Apokalypse zu den Überlebenden des
zweiten Lebens zu gehören, ebenso wie bei den frühbürgerlichen Gemälden, die die
Kaufleute aus Florenz und Venedig von sich selbst anfertigen lassen, um ihren
Tod zu überleben. Es lebt in der Lebensphilosophie wie im existenzialistischen
„Vorauslaufen zum Vorbei“ eines Martin Heideggers, in der Frage der „Urwahl“
Jean-Paul-Sartres oder im absurden „Dennoch“ eines Albert Camus angesichts des
Todes. Und indem Isenschmid das Jüdische so fassen will, legt er an Proust in
dieser Frage Maßstäbe eines Identischen an, das sich bei dessen Schreiben gerade
in einer Bewegung befindet. Proust trifft gerade keine Entscheidung für eine
französische, deutsche oder jüdische Welt; er beschreibt, er schreibt und lebt
und schafft so den Unterschied zwischen Leben, Sterben und Schreiben ab. Wenn es
ihm um Wahrheit und Aufrichtigkeit geht, so schließt er sich an das ethische
Projekt von Baruch Spinoza an. Das arbeitet Isenschmid sehr schön in seinem
ersten Kapitel heraus; es scheint ihm aber nicht auszureichen.
Und so hypostasiert er sein Konzept und fällt dahinter zurück. Denn wenn ein
Jüdisches existiert, dann doch wohl als der Spannungsbogen, in dem Marcel Proust
es in der Recherche darstellt: als Tendenz zur Assimilation der nach
Frankreich eingewanderten Juden mit ihrer doppelten Herkunft aus Spanien und
Portugal per Schiff und aus Deutschland, Polen und Russland per Land. Zu dieser
Assimilation gehört es dazu, sich gegen die nichtassimilierten Juden
auszusprechen, ja auch das Jüdische so zu verleugnen, wie der Pseudo-Messias
Sabbatai Zwi am 16. September 1666 sein entsprechendes Vorhaben aufgibt, als er
vom türkischen Sultan Mehmet IV. vor die Wahl gestellt wird, sich zum Islam zu
bekennen. Er tut es und dass er es tut, ist für seine Anhänger gerade das
Zeichen, dass es sich bei Ihm wirklich um den Messias handele. Auch das ist
jüdisch. Oder eben auch die messianischen gesonnen Juden, die auf dem Kongress
von Ahmadinedschad in Teheran 2005 dafür beten, dass der Staat Israel bald
untergehen wird, damit der Messias schneller komme.
So ambivalent wie Proust über das Jüdische schreibt, so ist es und es ist
wohlfeil, ihm nachzuweisen, dass er dabei schwankte, die Ebene zwischen Ästhetik
und Realität verwechselte und nicht wüsste, was er täte. In Wahrheit besteht
Prousts Kunst gerade in dieser Ambivalenz, nicht sein empirisches Ich davon
abgrenzen zu müssen.
Der
geteilte Himmel
Und so
endet Isenschmids Buch, wie es begonnen hat. Diese Ambivalenz lässt sich
nicht weiter aufklären. Wo Isenschmid über die wertvollen Details, die er zu
Prousts jüdischer Familie beibringt, zu einem übergeordneten Konzept
weitergehen will, fällt er hinter sich zurück. Er will zwei Erzähler in der
Recherche ausmachen, einen dichterischen, der die Erfahrungen seines
Liebeslebens preisgibt und einen historischen, der die Erfahrungen mit der
Assimilation von außen berichtet. Das sei das Wesen der Ambivalenz: „So viel
Einsicht. So viel Abstand. So, das wars.“ (S. 191) Als Leser sagt man:
Danke, aber das wussten wir schon auf Seite 23 besser. Das
Darüberhinausgehende hat dadurch etwas von Jorge Luis Borges Fiktionen.
Diese Kritik ist erst beendet, wenn der Kritiker zum Original geworden
ist. Andreas Isenschmid wähnt sich gleichsam als der Autor von Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit. Er ist unter Zeichen und Orakel unter
einem real geteilten und idealistisch identitären Himmel geraten, die es
beide bei Proust nicht gibt.
Artikel online seit 14.01.23
|
Andreas Isenschmid
Der Elefant im Raum
Proust und das Jüdische
Hanser Verlag 202
240 Seiten
26,00 €
978-3-446-27271-2
|