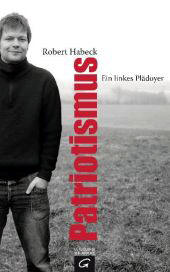|
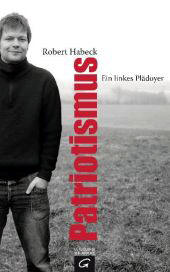 |
Pragmatische
Vision
Lothar
Struck zu Robert Habecks
anregender Diskussionsgrundlage
»Patriotismus -
Ein linkes
Plädoyer«
Die Feindschaft zum Staat
als Repressionsinstanz, "Atomstaat", "Bullenstaat", als paternalistischer
Akteur, Hüter fauler Kompromisse, verstellte den grünen Blick darauf, was (mit
einem) geschehen würde, wenn man selbst zu dem gehörte. Der zivile Mut wollte
immer über den Staat hinaus, zielte auf die Idee eines Gemeinwesens ohne Staat.
Als dann rot-grün 1998 an die Regierung kam, waren die liberalen
Vorstellungen von Gemeinwohl nicht mehr gegen, sondern mit dem Staat
durchzusetzen. Auf diesen Schritt waren die progressiven Kräfte schlecht
vorbereitet und sind es bis heute.
Hart geht Robert Habeck,
41, Fraktionsvorsitzender der Grünen im schleswig-holsteinischen Landtag, mit
der Linken im Allgemeinen und seiner Partei im Besonderen ins Gericht (womit die
politische Richtung und nicht dezidiert die Partei "Die Linke" gemeint ist).
Nach rot-grün, so Habecks These, habe das Land in einer Großen Koalition, die
ihre Chancen leider (!) sträflich verpasst habe, vier Jahre verloren.
Schwarz-gelb ist keinen Deut besser; die Lethargie spürbar, wobei er wohl
richtig liegt, dass es diese Koalition für längere Zeit zum letzten Mal gegeben
haben dürfte. Aber der dichotomische Lagerwahlkampf "rechts" gegen "links"
bringt uns nicht mehr weiter. Die Welt ist komplexer geworden; Mechanismen, die
in der Vergangenheit ihre Berechtigung hatten, greifen nicht mehr.
Habeck begnügt sich nicht
mit der Aufzählung der Fehler der anderen. Er wendet den Blick auf die
rot-grünen Regierungsjahre, um aus diesen Fehlern zu lernen. Er war jemand, der
sich einen gesellschaftlichen Aufbruch versprochen hatte; ein "Projekt". Elan
und Enthusiasmus waren groß. Und verpufften so schnell. Früh stellte sich
der Blues ein. Es gibt Gründe, die zu dieser Dialektik aus Versprechen
und Enttäuschung geführt haben. Aber letztlich geht es um Aufbruch und nicht
Rückblick. Dieser Aufbruch soll keine Fortführung einer Politik des kleineren
Übel[s] werden. Ernüchternd aber korrekt die Feststellung, dass es keinen
Fall in der jüngeren Geschichte gegeben hat, aus der die Linke als Siegerin
hervorging. Robert Habeck propagiert nicht mehr und nicht weniger als eine
Neuorientierung der politischen Linken, zu der er wie selbstverständlich die
Grünen zählt.
Der "Geschmack des Abgestandenen"
Einige
Diagnosen und Thesen sind aus der Feder eines Politikers durchaus verblüffend
und werden naturgemäss in bestimmten Kreisen für die (ritualisierte) Empörung
sorgen. Etwa wenn er schreibt, dass es der aufgeklärten Linken bisher
nicht gelungen sei, den Erzählungen über den Werteverfall einen neuen,
starken, aufregenden, die gesellschaftliche Debatte fokussierenden und
herausfordernden programmatischen Entwurf entgegenzusetzen. Ja, es ist ihnen
noch nicht einmal gelungen, herauszuarbeiten, um was für eine Debatte es
eigentlich geht. Wo linke Ideen geäußert werden, umgeben sie ein Gewand des
vergangenen und ein Geschmack des Abgestandenen. Marx hält er für
regressiv, sein Denken sei allzu stark auf die Ökonomie ausgerichtet.
Vehement seine Kritik an der Partei "Die Linke" und auch an die Jusos der SPD.
In den programmatischen, antikapitalistischen Politik- und
Gesellschaftsentwürfen der aktuellen Juso-Vorsitzenden Franziska Drohsel sieht
er nur eine latente Hilflosigkeit, mit altbackener Sozialismusromantik aktuelle
Probleme der Zeit lösen zu wollen.
Das Fundament für die neue Politik wird in der Überwindung der linksliberalen
Gleichgültigkeit gegenüber dem Staat gelegt. Jahrzehntelang waren Begriffe
wie "Patriotismus" oder "Gemeinwohl" zu Unwörtern geworden – natürlich durchaus
berechtigt aufgrund des hohen Missbrauchspotentials und in Anbetracht der
historischen Katastrophen zweier Weltkriege. Habeck sieht es nun an der Zeit,
der politischen Rechten diese Begriffe durch eine offensive Neudefinition zu
entreißen und selber produktiv zu machen. Im ersten Dritten und letzten Fünftel
seines Buches plädiert er eindringlich und durchaus gefällig für einen neuen,
linken Patriotismus, zu einem positive[n] Bekenntnis zu der Gesellschaft, in
der man agiert. (Dabei wirft Habeck auch seine persönliche Lebenssituation
in die Waagschale: er ist Vater von vier Kindern, Freiberufler und lebt mit der
Schriftstellerin Andrea Paluch zusammen.)
Gemeinwohl und Fan
Als Adressat und
Verbindung zwischen den Gegensätzen zwischen "Liberalität" und "Paternalismus",
zwischen "verantwortungsvoll" und "kreativ", zwischen "Bürger" und "Konsument"
braucht man ein positives Gesellschaftsverständnis. Man braucht es, um eine
sinnstiftende, politische Erzählung zu schaffen, die Zutrauen und Zuversicht
gibt, dass Veränderungen gut sind und es sich lohnt, für sie zu streiten. Man
braucht eine Erzählung, die auf Veränderung setzt, auf Gerechtigkeit und
Internationalität. Dieses Engagement nenne ich einen "linken Patriotismus".
Selbstredend, dass es
nicht um eine Wiederbelebung nationalistischer Umtriebe geht. Patriotismus als
Vaterlandsliebe lehnt Habeck ab. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen
und weiß es bis heute nicht heißt es arg nassforsch. Den Nationalstaat hält
er für überholt. Auch einen Regionalpatriotismus (und sei es als eine Art
"Überbrückung" zum Nationalstaat und sozusagen vorgeschaltet zu supranationalen
EU) lehnt er als politisch rückständig schroff ab; allerdings nicht ohne
zu gestehen, im Alltag gelegentlich selbst in diese Kategorie zu verfallen.
Dennoch sieht er nicht mit linker Verachtung auf die patriotischen Wellen
1989/90 und anlässlich der Fußball-WM 2006 herab. Aus den Erfahrungen mit den
beiden so unterschiedlichen Ereignissen versucht er, den Begriff des
Patriotismus vom nationalstaatlichen Mief zu entkoppeln. Statt als Angehöriger
eines Volkes solle man sich als Fan fühlen; ein nettes Gedankenspiel.
Freimütig bekennt er:
War es noch in den
rot-grünen Jahren schick, sich in die patriotische Gleichgültigkeit
zurückzuziehen, ziehe ich jetzt einen anderen Schluss. Ja, ich bin der Meinung,
dass es genau jenes unaufgeklärte Verhältnis zum Gemeinwohl war, das das
rot-grüne Projekt so schnell müde und nach Verrat hat aussehen lassen. […] Wenn
wir nicht auch das nächste Jahrzehnt zu Nulljahren machen wollen, dann muss die
gesellschaftliche Debatte nun raus aus ihren Löchern. Dass Deutschlands
Geschichte über weite Strecken eine der Barbarei war, heißt nicht, dass man sich
darum nicht zu scheren braucht, dass Zivilcourage und Einsatz nichts nützen.
Erstens würde man damit das Land nur erneut den Barbaren ausliefern, zweitens
würde man eine völkische Denkweise übernehmen, nämlich dass es so etwas wie den
Geist einer Nation gibt. Intellektuelle Redlichkeit zwingt zum Bemühen um einen
linken Patriotismus. Die ganze trotzige Haltung des Protests und der
Konfrontation ist heute eher ein Hindernis zu echtem Engagement.
Aus einer bloßen Romantik des Aufbegehrens führt, so die einleuchtende
und kluge These, der Weg durch die Institutionen schnell in eine
Assimilation mit dem bourgeoisen Bürgertum. Das wird am Beispiel von Gerhard
Schröder personalisiert, darf aber auch als Seitenhieb auf einige grüne
Anzugträger verstanden werden. Habeck will weg von der griesgrämigen
Linken, die sich in der Macht zu schnell zurechtfindet und ihre Ideale allzu
eilig einem falschen Pragmatismus opfert. Der Marsch durch die Institutionen
soll in kritischer Sympathie erfolgen, nicht in vorauseilender Abwehr.
Institutionspatriotismus
Habeck zitiert Rorty und
Habermas und plädiert in punkto Einwanderung für Integration statt Exklusion.
"Landsleute" sind für ihn nicht völkisch oder nach Abstammung definiert, sondern
alle im Land lebenden Menschen (was dann das eigentlich abgelehnte Prinzip der
Territorialität über die Hintertür wieder einführt). Einen Fragekatalog zur
Einbürgerung lehnt er ab. Am Horizont leuchtet bisweilen Ulrich Becks
kosmopolitischer Internationalismus auf, ohne direkt erwähnt zu werden. Linker
Patriotismus ist für ihn ein rationaler Gesellschaftsvertrag mit einer
emotionalen Ansprache, eine[r] gemeinsamen Idee, damit ein Pathos der
Zusammengehörigkeit entstehen kann, in dem das Gemeinwohl wieder neu
entdeckt wird.
Hehre und längst überfällige Worte – insbesondere auch, was die Selbstreflexion
angeht. Da der Name Habermas früh fällt und auf Seite 35 einem
Verfassungspatriotismus das Wort geredet wird, ist man überrascht, wenn als
Kronzeuge hierfür Richard von Weizsäcker genannt wird. Mit dem
Verfassungspatriotismus wird eine Gesellschaft von Bürgern angestrebt, die
sich ihrer Rechte, aber auch ihrer Pflichten bewusst sind. Habeck füllt
diesen Begriff allerdings kaum weiter aus. Er belässt es bei Umkreisungen und
beschwört Solidarität und Identifikation über Institutionen respektive das
Grundgesetz auszurichten. Ob man hiermit Fans gewinnt, bleibt fraglich.
Wenn dieser Institutionspatriotismus am Ende über die EU hergestellt
werden soll (wie Habermas präferiert er die EU als Bundesstaat), obwohl Habeck
durchaus kritisch konstatiert, dass die emotionale Zuspitzung zur
Europäischen Union fehlen, zeigen sich die Vorschläge dazu als ein bisschen
dürftig: Steigerung der Lebenszufriedenheit als Indikator statt ein ökonomisch
überaus zweifelhaftes "BIP"-Denken; Änderung des Wahlrechts (zu Gunsten aller in
Deutschland lebenden), um auch Migranten mehr in die Gemeinschaft einzubinden;
ein Zivildienst, der abgekoppelt vom Wehrdienst ist, aber freiwillig sein soll
(und vielleicht nur bei der Studienplatz- oder Ausbildungsplatzvergabe gewisse
Nominierungsvorteile bringen soll); Politiker, die auch in ihren Amtszeiten
Bürger bleiben und nicht "abheben".
Ausdrücklich bekennt sich
Habeck zum Kapitalismus und für das Ziel einer neuen, moralische[n] Art des
Wachstums. Beides sei politisch und ökologisch auszugestalten. So wird von
einem lokalpolitischen Projekt mit dem CDU-Ministerpräsidenten berichtet, in dem
er mit diesem und im Konsens mit Bürgerinitiativen und Investoren ökologische
Standards und ökonomischen Nutzen zusammengeführt habe, ohne "faule Kompromisse"
eingegangen zu sein. Antikapitalismus sei dumm. Demokratie funktioniere
ohne Markt nicht (umgekehrt – siehe China – übrigens durchaus). Die Wirtschaft
brauche Effizienz und Wettbewerb. Für Herstellung von Solidarität sei
allerdings die Politik verantwortlich, nicht die Wirtschaft, die originär andere
Ziele verfolge. Habeck zeigt anschaulich, wie die ideologische Pervertierung des
Begriffs der "Freiheit" durch marktliberale Kräfte seit Anfang der Achtziger
Jahre (für ihn ist das sogenannte "Lambsdorff-Papier" der Auslöser gewesen)
voranschritt (leider verwendet er den inkorrekten Begriff "neoliberal" hierfür
mehrfach).
Die Alternative schlanker
vs. schwacher Staat hält er für falsch und führt dies beispielhaft für eine
reduktionistische, auf Slogans fixierte, affektgesteuerte Politik auf (wobei er
abermals die eigene Partei nicht schont). Sein Unwort des Jahrzehnts
lautet alternativlos. Ausdrücklich muss immer jede Entscheidung für sich
gesehen werden. Mal kann es sinnvoll sein, dass sich der Staat zurückzieht, mal
ist es unumgänglich, dass er strenge Vorgaben macht oder gar das Ruder
übernimmt. Sehr interessant, wie er die falsche, linke Industriepolitik
der letzten Jahrzehnte kritisiert, die mit ihren Hilfen für Kohletagebau
[und] Autoindustrie entgegen aller Beteuerungen letztlich Konzernpolitik
war. Dazu hätte man gerne mehr gelesen, zumal Habeck ausdrücklich für einen
sanften Paternalismus eintritt, der zwar die Erziehung des Menschen zum
"richtigen" Verhalten ablehnt, aber sehr gezielt in entscheidenden Situationen
Anreize setzen möchte.
Ungenauigkeiten im Mittelteil
So heißt denn
das zweite Kapitel, welches mit rund einhundert Seiten fast die Hälfte des
Umfangs des Buches ausmacht, "Sanfter Zwang zur Freiheit". Eine Überschrift, die
ja durchaus dem Charakter grüner Politik entspricht. Der linke Patriotismus
dient hier als Fundament für einige gesellschafts- und sozialpolitische
Veränderungen, die durchaus interessant sind. Aber statt an zwei, drei Punkten
konkreter zu werden, widmet sich Habeck vielen unterschiedlichen Baustellen, und
dies durchaus nicht immer auf sicherem Terrain.
So kann man natürlich Ackermanns Ziel von 25%
Eigenkapitalrendite für sein Unternehmen kritisieren. Dies jedoch in Korrelation
zum prognostizierten Wirtschaftswachstum von 1% zu setzen und naiv zu fragen,
woher denn die anderen 24% kommen sollen, ist nur polemisch. Und auch die These,
Deutschland habe eine der niedrigsten Abgabenquoten in der EU wird nicht dadurch
besser, dass man sie ständig wiederholt (hier wird
Abgabenquote
mit
Steuerquote
verwechselt).
Und wenn Habeck für ein
gerechteres Steuersystem mit verlangsamter Progression eintritt, welches den
"Mittelstandsbauch" beseitigen soll, kommt vollends Konfusion auf. Wenn er
einerseits moniert, dass man (ohne Kinder) bereits mit einem Jahreseinkommen von
50.000 Euro den Spitzensteuersatz bezahlt, dann bedarf es der Erläuterung, warum
eine Seite später ein neues Steuersystem skizziert wird, welches etwa bei
einem Einkommen von 3500 (sic!) die Grenze für einen besser/schlechter
Schnitt sieht. Vermutlich ist in einem Fall das Bruttojahreseinkommen, im
anderen Fall das Nettomonatseinkommen gemeint – aber das hätte man durchaus
präziser erläutern müssen (eine der Situationen, die nach einem Lektor rufen
lässt [eine andere ist, wenn DBI steht und BDI gemeint ist]).
Allerlei weitere kleine
Ungereimtheiten entdeckt der aufmerksame Leser. Das steigende Lohnniveau in
Großbritannien zu preisen ist eine Sache – zu ergründen, woher dies kommt und
welche sozialstaatliche Absicherung damit eigenfinanziert werden muss, eine
andere. Die Ökonomisierung bzw. Monetarisierung der Gesellschaft wird durchaus
beklagt, aber andererseits als "Kosten" für Kindererziehung das pauschale
von-der-Leyen-Diktum zitiert (wie ein Einfamilienhaus - welche Lage darf
denn das Haus haben).
Emphatisch tritt Habeck
für eine Gleichsetzung der Sozialsätze von Erwachsenen und Kindern ein
(eigentlich möchte er sogar mehr für Kinder). Hierfür nennt er sehr gute Gründe,
allerdings auch den, dass man den stärkeren modischen Interessen von Kindern
nach Markenprodukten Rechnung zu tragen habe. Damit ist er dann plötzlich
vom an anderer Stelle so heftig kritisierten Sozialromantizismus nicht weit
entfernt. Und wie seltsam von ihm plötzlich zu hören, der Staat sollte sich
gesellschaftspolitisch zur Idee von Individualität bekennen und
beispielsweise das Ehegattensplitting, die kostenlose Krankenmitversicherung
oder eben auch die Bedarfsgemeinschaften im Hartz IV-Bezug, abschaffen.
Jeder dieser Punkte kann zwar für sich durchaus gut begründet werden, aber ein
wenig konterkariert Habeck hier seinen Gemeinwohlappell, in dem er sowohl die
pekuniären wie die gesellschaftlichen Folgen von überindividualisierten
Entitäten gänzlich ausblendet.
Gänzlich überhastet wird der Vorstoß der Besteuerung der Arbeitszeit in den
Unternehmen vorgebracht. Staatlicherseits soll ein Arbeitszeitdurchschnitt
festgesetzt werden, entlang dem sich eine Besteuerung vollzieht,
beispielsweise eine Arbeitszeit von 30 bis 36 Stunden. Bei Überschreitung der
Arbeitszeit beginnt die Besteuerung des Betriebsgewinns, progressiv ansteigend.
Weil Habeck kurz vorher die starren Tarifarbeitszeitmodelle für nicht besonders
betriebsgerecht empfunden hatte, überrascht diese Festlegung schon. Leider
erwähnt er weder, wie diese Durchschnittsarbeitszeit ermittelt wird noch wer
dies kontrollieren soll.
Bildungsgeld als "bedingungsarmes Grundeinkommen"
Der Idee des
sogenannten Bildungsgeldes widmet Habeck mehr Raum. Interessant dabei ist, dass
er sich damit von programmatischen Entwürfen einiger grüner Landesverbände, die
zum sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen tendieren, entfernt. Nicht, dass
er glaubt, die Menschen würden alle zu Faulenzern, aber er führt Untersuchungen
aus den USA an, die in Experimenten eine Unzufriedenheit bei Empfängern von
bedingungslosem Grundeinkommen festgestellt haben; die Scheidungsraten seien
höher und der durch den beruflichen Trott strukturierte Tagesablauf fehle (das
Fehlen eines Quellenverzeichnis ist besonders jetzt ärgerlich). Stattdessen
schlägt er ein bedingungsarmes Grundeinkommen vor, und zwar für alle,
die bereit sind, sich fort-, aus-, neuzubilden. Gezahlt wird dies auf
maximal fünf Jahre; als Betrag rechnet Habeck 800 Euro pro Monat aus. Der Satz
liegt damit gewollt leicht über dem BAföG-Höchstsatz und auch über dem
ALG-II-Regelsatz. Er ist nicht vom Einkommen der Eltern abhängig und vor
allen Dingen nicht aufs Studium beschränkt. Obwohl ein Gegner von
Studiengebühren, sind diese mit 500 Euro pro Semester berücksichtigt.
Unter Berücksichtigung bisher bereits gezahlter Zuschüsse
kostet das Bildungsgeld im vorgeschlagenen Rahmen rund 20 Milliarden Euro
zusätzlich. Habeck schlägt als Finanzierung eine wiederzubelebende
Vermögenssteuer von ca. 1% vor, die jedoch mit großzügigen
mittelstandsfreundlichen Freibeträgen ausgestattet werden sollte, um nur die
wirklich Vermögenden zu "treffen". Als Alternative wird noch die sogenannte
Sozialerbschaft
aufgeführt, in der ein fester Betrag in Höhe von 60.000 Euro auf Wunsch jedem
Bürger einmalig und voraussetzungslos zur freien Verfügung bereitgestellt werden
soll.
Da das Bildungsgeld an
einen wie auch immer vorhandenen Schulabschluss andockt (und die Zuwendungen
unter Umständen an bestimmte Grundvoraussetzungen gekoppelt sein sollen),
rechnet Habeck neben einer Neujustierung der gesellschaftlichen Mechanismen,
welche einen neuen gesellschaftlichen Aufbruch organisieren könnten, auch
mit dem willkommenen Nebeneffekt einer bürgergetriebenen Reform unseres
Bildungs- bzw. Schulsystems, welches als Grundvoraussetzung plötzlich andere
Priorität bekäme. Auch in punkto Generationengerechtigkeit wäre man einen
Schritt weiter, da man davon ausgehen kann, dass insbesondere jüngere Menschen
dieses Angebot annehmen werden.
Auch wenn Details noch
nicht bis ins Letzte ausformuliert sind, lässt sich der Leser hier gerne vom
Enthusiasmus des Autors anstecken. Leider bleiben jedoch seine Ausführungen
hinsichtlich der Reorganisation des Bildungswesens ein bisschen eindimensional:
Abschaffung des Bundesbildungsministeriums und der Kultusministerkonferenz unter
gleichzeitiger Stärkung der Autonomie der jeweiligen Bildungseinrichtung
(Schule, Universität), der Wunsch einer Reform der Oberstufe und das Plädoyer
für weniger Frontal- und mehr Teamunterricht (der Lehrer als Helfer) -
das ist alles nicht mehr ganz neu und bedürfte detaillierterer Ausschmückung.
Weiterhin wird die Möglichkeit skizziert, dass Schüler ihre Zensuren selber
verwalten könnten. Wo Habeck in Anbetracht der vorliegenden Studien "Streber"-Schulen
ausmacht (anhand des sogenannten Turboabiturs soll dies abgeleitet werden),
bleibt diffus. Desweiteren werden die Ursachen für die Gleichgültigkeit
gegenüber Bildung in breiten Bevölkerungsschichten ignoriert. Hier wäre man sehr
interessiert, mehr über seine Anreize zu erfahren.
Solide und anregende Diskussionsgrundlage
Trotz aller Vorbehalte ist das Buch mehr, als man
von so manchem Sonntagsredner in unzähligen Talkshows gehört hat. Zwei
Kardinalfehler macht Habeck bei der Politik von heute aus: An die wirklich
großen Veränderungen traue man sich nicht heran und strukturell hinke
die Politik der gesellschaftlichen Entwicklung immer hinterher. Der
letzte Einwand ist ein wenig arg pauschal; der erste völlig richtig.
Strukturelle Vorschläge zu einer Umorganisation politischer Institutionen macht
er allerdings nicht (nur einmal deutet er an, dass er das Mehrheitswahlrecht
fürchtet). Lösungen, die aus selbstbezüglichen Strukturen des
Politikersystems kommen verabscheut er und sieht sie als Ursache für den
Rückzug ins Private vieler Bürger. Habeck ist überzeugt von einem relevanten
Interesse an Politik, welches mit zurückgehendem Engagement in Parteien und
Verbänden nicht verwechselt werden dürfe. Unengagiert ja, unpolitisch nein. Die
These, die produktive Unruhe werde bewusst kaltgestellt ist kühn,
aber nicht gänzlich von der Hand zu weisen, wenngleich man Ursache und Wirkung
untersuchen müsste.
Habeck bekennt sich zu Visionen, die Antwort[en] auf die Sinnsuche zu
geben haben (und nicht mit Utopien verwechselt werden dürfen). Er sagt Ja zur
Kraft der Idee und hat keine Probleme damit, als Idealist bezeichnet zu
werden. Wechselnde Mehrheiten sieht er nicht per se als Katastrophe an und wähnt
sich dabei – vermutlich richtigerweise – auf der Seite der Mehrheit der
Bevölkerung, die sachbezogene Entscheidungen wünscht und nicht aufgrund
parteipolitischer Taktiken. Seine Thesen zu einem Aufbruch…jenseits der alten
Schubladen und Schablonen sind für den Leser politisch-theoretischer
Schriften beileibe nicht unbekannt. Dass ein linker Politiker diese
Überzeugungen aufnimmt und fruchtbar machen will, ist dagegen neu und
erfreulich. Robert Habeck würde der Satz, dass sich ein Land glücklich schätzen
darf, solche Politiker (noch) zu haben, nicht gefallen. Aber so was muss auch
einmal gesagt werden. Lothar Struck
Die
kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
|
Robert Habeck
Patriotismus
Ein linkes
Plädoyer
Gütersloher Verlagshaus
207 S., Gebundenes Buch mit Schutzumschlag
ISBN: 978-3-579-06874-9
19,95 €
|