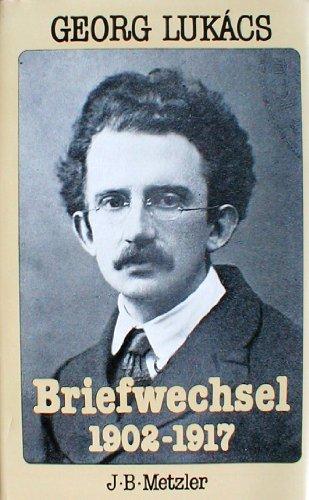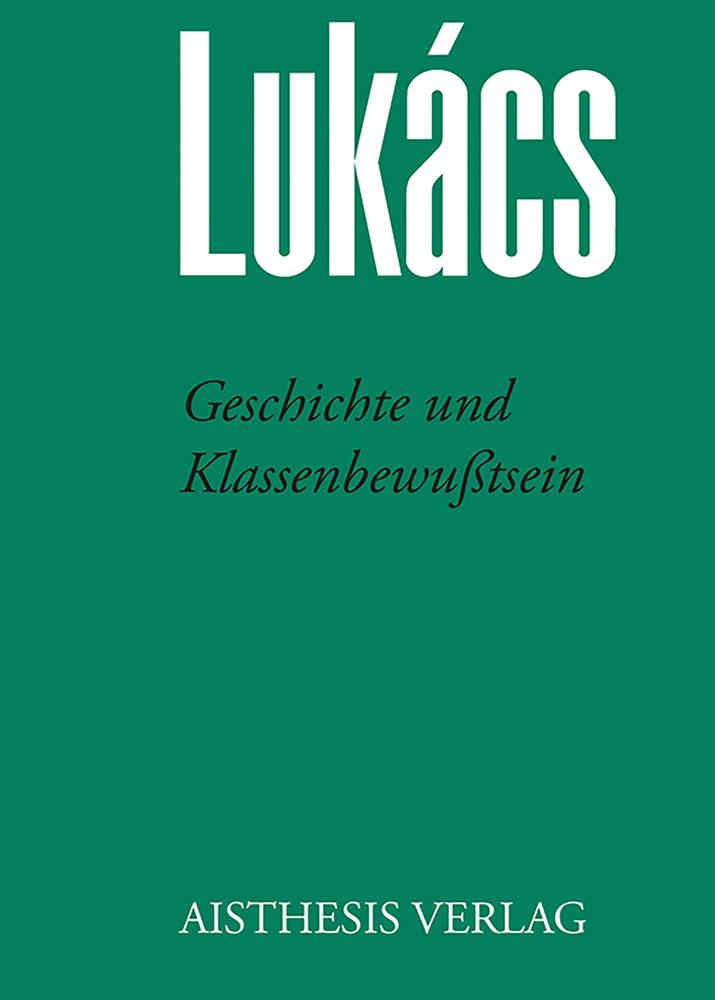|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
|||
|
Ernst raucht 1932 mit Georg eine Zigarre, und man versteht sich Über die Möglichkeiten und Grenzen argumentativen VerstehensEin Gedankengang von Peter Trawny |
|||
|
Ich stelle mir vor, Ernst Jünger und Georg Lukács wären sich vielleicht 1932 in Berlin begegnet (wo sonst?) und hätten die politische Lage diskutiert. Der eine galt als geheimer Anführer der Bündischen Rechten, der andere als brillanter Kopf der Linken. Der eine hatte mit »In Stahlgewittern« einen Klassiker der Kriegsliteratur, der andere mit »Geschichte und Klassenbewußtsein« ein Schlüsselwerk der linken Theorie geschaffen (bitte, niemals nebeneinander ins Regal stellen!). Sie hätten sich wohl Vieles zu sagen gehabt. Jünger hätte von der »totalen Mobilmachung« geredet und von der »Gestalt des Arbeiters«, Lukács hätte womöglich von der »Verdinglichung« gesprochen und davon, dass seit dem Oktober 1918 »die Partei« das eigentliche revolutionäre Subjekt geworden sei. Jünger kannte sogenannte »Nationalbolschewisten«. Natürlich las Lukács Jünger. Könnte sein, dass man sich bei Weinbrand und Zigarren näher gekommen ist, im intellektuellen Austausch Vergnügen gefunden hat. Sie sind sich übrigens wirklich begegnet. Ist denkbar, dass Jünger ein Fürsprecher »der Partei« geworden wäre? Ist‘s möglich, dass Lukács von der »Gestalt des Arbeiters« die Zukunft erwartet hätte? Bei aller Nähe, bei allem Vergnügen sind sie politische Gegner geblieben — und zwar unversöhnliche. Jünger wurde kein Kommunist, und Lukács verhandelt Jünger in seinem Buch »Die Zerstörung der Vernunft« unter der Überschrift »Präfaschistische und faschistische Lebensphilosophie«. Man muss bei allem möglichen Verständnis zwischen »Rechten« und »Linken« davon ausgehen, dass sich die Begründung der eigenen Position nicht diskursiv vollzieht (bei den »Rechten« ausdrücklich nicht, bei den »Linken« in dialektischem Widerspruch ausdrücklich doch — was den Widerspruch bestätigt). Deshalb ist eine Übernahme der anderen Position ausgeschlossen. Oder würde sich heute ein bekannter »Linker« — ganz gleich, welchen Geschlechts, und gleichgültig, ob Philosoph, Schriftsteller oder Politiker — anheischig machen, zu behaupten, dass er durch entsprechendes Verstehen ein »Rechter« werden könnte? Also warum dann überhaupt — Verstehen? Ernst und Georg haben sich verstanden. Sie verfügten beide über die intellektuelle Fähigkeit, die Position des anderen zu durchdringen, so wie sie beide das Talent hatten, ihre Position deutlich zu machen. Sie wollten wohl beide sogar das Gleiche, nämlich das Ende der Weimarer Republik, den Untergang dieser sich zerfasernden Demokratie. Und dennoch hat das Verstehen eine Grenze, an der das Unteilbare, das Eigene, das politische Projekt beginnt. Die Entstehung und Vertretung politischer Positionen sind der Philosophie unzugänglich — vor allem dann, wenn sie einzig und allein das »Argument« beansprucht. Warum Jünger sich in der Weimarer Republik auf der extremen »Rechten« gegen die Demokratie engagiert hat, wird — selbst wenn er einen autoritär-nationalistischen Staat als den besten bezeichnet hat — wahrscheinlich auch ihm selbst nicht restlos klar gewesen sein. Lukács hätte bei seiner intellektuellen Physiognomie gewiss behauptet, alle Argumente auf seiner Seite zu haben: Die Revolution löst alle Probleme — doch wir wissen, dass Lukács nicht Recht hatte. Aber wir wissen auch, dass es darum in der Politik nicht geht. Es war übrigens Hannah Arendt, die einmal feststellte, dass »die Philosophie« »sich immer mit dem Menschen« beschäftige und, »da alle ihre Aussagen richtig wären, auch wenn es entweder nur Einen Menschen, oder nur Zwei Menschen, oder nur identische Menschen gäbe«, »keine philosophisch gültige Antwort auf die Frage: Was ist Politik? gefunden« habe. Wir sind zwar heute philosophisch weiter und haben das metaphysische Denken der ungebrochenen Identität mehrfach gebrochen. Und doch sind wir immer noch — zumal im Argumentieren — die Fürsprecher der einen Vernunft. Wer die politischen Argumente des anderen verstehen und so beurteilen will, wünscht sich eine harmonischere Gegnerschaft, also dass es — wie zwischen Ernst und Georg — zu keiner praktischen Gewalt kommt etc. Man fordert mit der Einhaltung des demokratischen Geistes und seines Grundgesetzes heute gleichsam ein Bekenntnis zum Argument — und damit zur einen Vernunft? Solange dieses Bekenntnis gilt, kann man diskutieren, kann man »verstehen«. Wer das Bekenntnis verweigert, scheidet aus.
Mag sein: Doch im politischen Streit — scheint mir — geht es um etwas, das im
»aktuellen Diskurs« selten thematisch wird: nämlich um Macht. Im Streit um die
Macht wird das gegenseitige Verstehen — wie Ernst und Georg wussten —
zweitrangig. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn die Macht lässt sich nicht
immer von bestehenden politischen Systemen begrenzen. In ihren gewalttätigen
Eruptionen reißt sie Bestehendes nieder, um Neues zu errichten. Und es wird zwar
vielleicht möglich gewesen sein, das zu verhindern. Doch niemand weiß immer, was
möglich ist. |
|
||
|
|
|||