|
In den frühen Morgenstunden des 21. März 1973 erschoß sich in Offenbach
am Main der Philosoph, Autor und Übersetzer Dieter Leisegang. In den
Stunden zuvor hatte er Briefe geschrieben. Einer war an die
Kriminalpolizei gerichtet, in dem er seinen freien Entschluß zum Freitod
mitteilte, und daß er die Waffe, von deren Existenz niemand Kenntnis
gehabt habe, während seines Aufenthaltes in Südafrika eigens zu diesem
Zwecke erworben hatte.
Bis
zu seinem Freitod hatte Leisegang neben einigen kleinen, z.T. selbst
verlegten Gedichtbändchen (»Bilder der Frühe«, »Übung eines Weges«,
»Brüche«, »Überschreitungen«, »Intérieurs«, »Hoffmann am Fenster«,
»Unordentliche Gegend«, »Aus privaten Gründen«), Essays (»Die Form
sichtbar machen«, »Die Welt lesen«, »Aber trenne die Schichten ...«) und
philosophische Schriften (u. a. »Dimension und Totalität«)
veröffentlicht. Er übersetzte W. H. Auden, Hart Crane und Edvard Kocbek
ins Deutsche, und schrieb für das Hessische Fernsehen Kulturbeiträge u.
a. »Ich schreibe ... Resignation und Tendenz in der deutschen Lyrik nach
Auschwitz«.
Leisegang hatte 1969, 27-jährig, mit »valde
laudabile, summa cum laude« bei T.W.Adorno und Julius
Schaaf seine Promotion in Philosophie (»Die drei Potenzen der
Relation«) abgelegt und einen Lehrauftrag für Geschichte der
Philosophie, insbesondere der Kunsttheorie an der
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität erhalten.
Bereits als 26-jähriger hatte er an der Werkkunstschule Offenbach am
Main einen Lehrauftrag für Ästhetik erhalten, sowie eine Dozentur für
Text und Rhetorik an der Fachschule für Industriewerbung und
Absatzförderung in Kassel.
 Von
1971 bis zu seinem Freitod war er als Cheftexter und Konzeptionist bei
der Deutschen Olivetti in Frankfurt/M beschäftigt, 1972 unterbrochen
durch eine Gastdozentur an der University of the Witwatersrand in
Johannesburg, Südafrika. Von
1971 bis zu seinem Freitod war er als Cheftexter und Konzeptionist bei
der Deutschen Olivetti in Frankfurt/M beschäftigt, 1972 unterbrochen
durch eine Gastdozentur an der University of the Witwatersrand in
Johannesburg, Südafrika.
Das ist mehr als ordentlich für einen Jungen, der am 25. November im
Kriegswinter 1942 als zwölftes Kind des Malers und Kartographen Gustav
Leisegang geboren wurde, und, wahrscheinlich bedingt durch die
Mangelernährung der Kriegs- und Nachkriegsjahre, an Tuberkulose
erkrankte. 1966 mußte er sein Studium unterbrechen, und war mehrere
Monate in einem Davoser Sanatorium in Behandlung. Sein Aufenthalt auf
dem Zauberberg konnte ihn jedoch nicht vor einer Operation bewahren, bei
der ihm 1967 ein Teil eines Lungenflügels entfernt werden mußte.
Trotzdem rauchte Dieter Leisegang. Er rauchte viel.
»Inhalierend Virginias / Riesige Felder«
sitzt er, unzeitgemäß korrekt, mit weißem Hemd, Krawatte und Weste
gekleidet, vor seinen Büchern am Schreibtisch und sieht den Betrachter
an. Er schaut ihm in die Augen, den Kopf leicht geneigt, die Zigarette
im Mundwinkel als Zeichen seiner Selbstbewußtheit, fordert er den
Betrachter heraus, seinem Blick standzuhalten.
Die trotzige Ernsthaftigkeit, mit der sich Dieter Leisegang in seiner
äußeren Erscheinung, wie in seinem Selbstverständnis als Künstler
mit seiner »mühseligen
Arbeit an den Zügen des Menschlichen« vom politischen und ästhetischen Mainstream der späten 60er und frühen 70er Jahre
abgesetzt hat, war
wohl mit ein Grund, warum er eine Randfigur des Literaturbetriebes
geblieben ist.
Wenn er sich bewarb, sprach er einmal vor. Schmeicheleien haßte er,
Penetranz war ihm zuwider. Reiner Kunze hatte recht, als er fragte »... wo
war Eure anspruchsvolle Literaturkritik, als Leisegang auftauchte?« Die
war da, kam aber mit Leisegang zu Lebzeiten nicht zurecht.
Einer, »der
für keine Partei wirbt« war im hochpolitisierten Kulturbetrieb nicht zu
gebrauchen. Erst nach dem Schuß im Morgengrauen hatte sie Verwendung für
Dieter Leisegang. Nun, da er sich verabschiedet hatte »Keine weiteren
Reden. Papa und der liebe Gott erwarten mich zum Kaffee«, ließ es sich
trefflich über das »rettungslose Ich« mutmaßen. Büchner und Kleist
wurden als seine Brüder im Geiste heraufbeschworen. Ehemalige Lehrer
erinnerten sich plötzlich, daß der »Hochbegabte« sie bereits als
Obersekundaner in Diskussionen über Kleists Selbstmord verstrickt habe.
 1980
erschien bei Suhrkamp der Band »Lauter letzte Worte« mit Gedichten,
Miniaturen und einem Nachwort von Karl Corino, das unter dem Titel »Das rettunglose
Ich«, die Unausweichlichkeit von Leisegangs Freitod zu belegen versucht: »Mit Dädalus. Dädalus hat der Autor sein Kardinalsthema, den Suizid,
wohl erstmals auf der Ebene der Kunst formuliert, jene schmerzliche
Entelechie, die sich 14 Jahre später vollendete.« Und: »Er
beschwor den Tod in immer neuen Bildern und fristete das Leben von
Gedicht zu Gedicht.« 1980
erschien bei Suhrkamp der Band »Lauter letzte Worte« mit Gedichten,
Miniaturen und einem Nachwort von Karl Corino, das unter dem Titel »Das rettunglose
Ich«, die Unausweichlichkeit von Leisegangs Freitod zu belegen versucht: »Mit Dädalus. Dädalus hat der Autor sein Kardinalsthema, den Suizid,
wohl erstmals auf der Ebene der Kunst formuliert, jene schmerzliche
Entelechie, die sich 14 Jahre später vollendete.« Und: »Er
beschwor den Tod in immer neuen Bildern und fristete das Leben von
Gedicht zu Gedicht.«
Ich kann diese
romantische Versuchung
zwar emotional nachvollziehen, halte
allerdings dagegen, daß es, rational betrachtet, niemandes »Bestimmung«
sein kann, sich
das Leben zu nehmen.
Indes - Dieter Leisegang hatte offenbar für sich
selbst schwer genug wiegende Gründe, dies zu tun. Private, die uns hier
nichts angehen und philosophische, über die man nachdenken darf.
Wer einen Blick in Leisegangs letzte Veröffentlichung, den Aufsatz »Dimension und Totalität - Entwurf einer
Philosophie der Beziehung« wirft, liest dem Text vorangestellt ein Zitat
von Pierre Teilhard de Chardin »Totalisieren ohne zu entpersonalisieren.
Zugleich das Ganze und die Elemente retten. Darum geht es.«
Darunter wollte es der Autor offenbar nicht machen: Das Ganze und
die Elemente ... retten... Ausgerechnet er, der von sich selbst sagte:
»In meinen philosophischen Arbeiten komme ich mir vor wie ein Bauer, der
sich vergeblich bemüht, Hochdeutsch zu reden.«
Hören wir doch mal rein:
»Es geht darum, das, was ist, auf eine rationelle Weise und in
grundlegendem Sinne zu begreifen. Bevor das, was ist, nicht derart
begriffen wird, kann von ihm keine artikulierte Rede sein. Beantworten
zu wollen, was denn das, was ist, sei, bevor es begriffen wurde, ist
schlechthin unmöglich. Begreife ich das, was ist, so auch in ihm eo ipso
das, was war und sein kann. Das, was ist, ist immer zugleich die gesamte
Geschichte seines Gewordenseins und Werden-Könnens. Es repräsentiert,
indem es das, was es ist, ist, den Entwurf seines Sein-Könnens, seines
Vollzugs in die Zukunft seiner selbst, mit. Der Entwurf hält das, was
ist, in einem Netz von Möglichkeiten gefangen. Dieses 'Netz von
Möglichkeiten' weiß, wer weiß, was das, was ist, ist.«
Diese von Heidegger und Wittgenstein imprägnierten, atemlos aber präzise
gesetzten Wertmarken spiegeln Leisegangs hohen intellektuellen Anspruch
an sich selbst, und lassen jene
existentielle Verzweiflung ahnen, welche
Kierkegaard einst die
Krankheit zum Tode
genannt hat, und mit der Leisegang
um verläßliche Erkenntnis von Identität, um die
»Züge des Menschlichen«
gerungen haben mag.
Hans Blumenberg schreibt in seinem eben erschienenen Buch »Beschreibung
des Menschen«: »Nur
der Mensch kann leben und dabei unglücklich sein. Er kann also gerade
das verfehlen, was ihm der Sinn seines Daseins zu sein scheint. Noch
wenn er Selbstmord begeht, wendet er einen letzten aller seiner
Kunstgriffe an: er versucht Selbsterhaltung um jeden Preis, selbst den
des Lebens, um wenigsten die Möglichkeit seiner Identität nicht selbst
dementieren zu müssen. Der Tod läßt sie, wie sein natürlicher Eintritt
sonst auch, offen. Insofern gehört die Möglichkeit der Selbsttötung zu
den Auszeichnungen eines Wesens, dem das Gelingen seines Daseins nicht
zuverlässig programmiert ist.« So gesehen lag in Leisegangs »Netz von
Möglichkeiten« auch die »rettende« Waffe, die er sich in Südafrika
besorgt hatte ...
Herbert Debes
ps
Dieter Leisegang ist mit seinem Gedicht »Einsam und allein«
(Einsam ist ja noch zu leben) in dem von
Marcel Reich-Ranicki herausgegebenen Kanon »Die deutsche Literatur -
Gedichte« vertreten.
Drei Gedichte:
Dieter Leisegang
Einsam und allein
Einsam ist ja noch zu leben
Hier ein Ich und dort die andern
Kann durch die Alleen wandern
Und auf Aussichtstürmen schweben
Einsam ist noch nicht allein
Hat noch Augen, Ohren, Hände
Und das Spiel der Gegenstände:
Und die Trauer, da zu sein
Doch allein ist alles ein
Ist nicht da, nicht dort, nicht eben
Kann nicht nehmen oder geben
Leergelebt und allgemein
Oktober 1972
Coca-Cola
für
Jolei
Natürlich wissen wir, wenn wir arbeiten, nie recht
ob alles dies, was uns einfällt, an Objekten, an
Wortverbindungen, nicht einfach überflüssig
längst getan ist, von solchen, denen ihr Tun
noch notwendig war. Wir beide aber, dessen eingedenk
haben uns ganz in uns selbst entwickelt: kein
Äußeres läßt uns noch aufhorchen. Gerade weil
heute alles nach außen geht, das Private verfemt ist
als Chinoiserie, und die Lösung unsrer Probleme
abhängen soll nicht von »Kunst und nochmals Kunst«
sondern von Politik, Haltung, Gewissen, haben
wir unseren Frieden innen errichtet: Du, in Deinen blauen
Stuben, und ich, etwas anspruchsvoller, so mir vorm
Fenster das vorbeifließt, was alt wie der Main ist
auch einige Blicke mir reichen bis an die
Ausläufer der Wetterau. - Unsre wenigen Freunde
sind gerne bereit, uns schweigend zu nehmen: mithin
fallen nur selten Worte übers Metier, da es uns
ohnehin schwer ist, und wir nicht einhergehn
wollen als Retter der Menschheit, auch keine
Gedanken verschwenden an die großen
weltbewegenden Dinge, ja, eher zu sagen bereit sind:
alles ist gut. Wirklich, dies Insichsein ist selten
geworden. Immer wieder müssen wir sehen: dieser fällt ab
und jener wird sich fremder in unserem Kreis -
Gegen die Schulen ist nichts zu sagen. Wir
lernten zumindest, einiges Verständnis zu
haben. Aber es ist traurig, in unserem Alter schon
weis sein zu müssen. Jedenfalls durchschaut sich die
Verlogenheit dieser uns aufgezwungnen Natur, weswegen
allmählicher Abstand auch davon nicht teuer käme –
Ich, für meinen Teil, bin (und Du sicher auch) mit
jedem Ende einverstanden. Wenn das Machen von Kunst
in unseren Räumen unmöglich wird, stellen wir's ein
Was wäre schon verloren, wieso soll uns dies
»Immer und ewig« in Fraktur überm Küchentisch hängen?
Wir könnten uns sicher ebensogut mit anderm befassen
Einem, dem man seine fatalen Züge (ein jegliches hat
sie) lieber verziehe. - Die Stadt, in der wir leben
hat gegen jede Erwartung weder Tradition noch
Kultur. Kein Cafe, wo Modigliani oder Sartre jemals
einen Stuhl berühmt gemacht hätten, keine Solitude, die
wenigstens Schiller durchschritten, nichts, was den
Atem nimmt; also können wir existieren bei jedem
Wetter, Katastrophen größeren Ausmaßes würden uns
allenfalls die Spaziergänge (die uns wesentlich sind)
kosten, mehr aber nicht. Unauffällig gekleidet, wie
wir sind, ist es uns möglich, unterzutauchen, im
abendlichen Betrieb mitzuschwimmen, einen VW zu fahren
und endlich: allein zu sein in der friedlichen
Art ausgeruhter Leute. - Auf jeden Fall haben wir uns
abgewöhnt, Du mit einiger Leichtigkeit und auch ich
mehr im Vorbeigehn, irgendeine Schuld bei uns zu suchen
für irgend etwas. Sind wir betrübt, so schieben wir
alles aufs Klima. Dieser Pragmatismus, der sich bei
uns längst bewährt hat (so sind wir nämlich alles andre
als Land-Läufige), ist nur eine Folge unserer
gar nicht heimlichen Liebe zu Amerika, wo der Betrieb
noch größer, der Zerfall dessen, was Bildung heißt
noch hinreißender sein soll. - Unser Religionsersatz
läßt sich in einem Namen ausdrücken: Coca-Cola. Sicher
geht es dem gut bei uns, hie und da nur erwähnt
ohne Emphase, ohne jeden Aufwand an Stimmkraft
uneigentlich also, da jede auch noch so geringe
Verehrung in Anbetracht dieses Gegenstandes
anheim fiele der Lächerlichkeit (mit unserer Abneigung
gegen Kabarettistisches, gegen Dada und
solcherlei wäre schon ein Kleines davon unverträglich) –
In der Ewigkeit erst scheiden sich unsre
Geister, denn Verschiedenes meinen wir wohl
mit ein und demselben (Deine Bilder, meine Verse)
So können wir unbesorgt um unser Eigenes
einander die Sätze ergänzen, die ohnehin nur
äußerst rhapsodisch ins Stille fahren (»zu sagen des
Herzens Meinung« ist uns das Liebste zwar: doch
selten, bitte! Nicht immerfort!); aus zwei Mündern
trägt unser Monolog sich vor, eine Rede, die für
keine Partei wirbt, auch nicht für die unsre. Vielleicht
macht dies uns einigermaßen erträglich: den
andern

Die alten Themen
Noch einmal vor der Kunst stehen
Mit solcher Nüchternheit und Ehrfurcht
Wissend, daß der Ernst sie bewohnt
Diese mühselige Arbeit
An den Zügen des Menschlichen
Wie man vor ihr stand als Zwölf-
Dreizehnjähriger: sich
Bei Regenwetter aus Bachs Notenbüchlein
Erneuerte (jenseits von Lust und
All dem Vergeblichen)
In Herrmann und Dorothea geblättert
Kurzgeschichten von Hawthorne, die man
Nie mehr los wird
Weil sie von Herbstfarben durchzogen sind
Bevölkert von unaufdringlichen Einsamkeiten
Nur manchmal noch, gegen Abend
In der Erinnerung an sterbende Zimmer
(Von Straßen spärlich umrandet) spielen
Wie aus längst verschlossenen Räumen
Die alten Themen herüber
24. Februar 1969
|
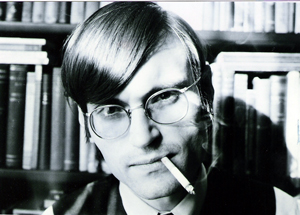

 1980
erschien bei Suhrkamp der Band »Lauter letzte Worte« mit Gedichten,
Miniaturen und einem Nachwort von Karl Corino, das unter dem Titel »Das rettunglose
Ich«, die Unausweichlichkeit von Leisegangs Freitod zu belegen versucht: »Mit Dädalus. Dädalus hat der Autor sein Kardinalsthema, den Suizid,
wohl erstmals auf der Ebene der Kunst formuliert, jene schmerzliche
Entelechie, die sich 14 Jahre später vollendete.« Und: »Er
beschwor den Tod in immer neuen Bildern und fristete das Leben von
Gedicht zu Gedicht.«
1980
erschien bei Suhrkamp der Band »Lauter letzte Worte« mit Gedichten,
Miniaturen und einem Nachwort von Karl Corino, das unter dem Titel »Das rettunglose
Ich«, die Unausweichlichkeit von Leisegangs Freitod zu belegen versucht: »Mit Dädalus. Dädalus hat der Autor sein Kardinalsthema, den Suizid,
wohl erstmals auf der Ebene der Kunst formuliert, jene schmerzliche
Entelechie, die sich 14 Jahre später vollendete.« Und: »Er
beschwor den Tod in immer neuen Bildern und fristete das Leben von
Gedicht zu Gedicht.« 