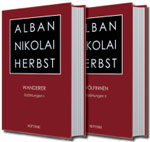|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
||
|
Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |
||
|
|
||
|
|
Vom Existieren |
|
|
Erzählungen sind so ein spezielles Literaturding: frei nach Goethe Sentenz »Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; und jeder geht zufrieden aus dem Haus.« Ich finde, das stimmt zwar einerseits und stimmt doch nicht ganz. Denn es stellt sich eben oft auch der Effekt ein, daß einige Erzählungen hängen bleiben, andere aber durchrauschen und ich schon nach vier weiteren Erzählungen nicht mehr weiß, was in jener ersten geschah. So zumindest geht es mir oft, und das macht mich nicht wirklich zufrieden, und deshalb lese ich Erzählungen nicht so gerne wie Romane – bei Harald Brodkeys »Unschuld. Nahezu klassische Stories widerfuhr es mir damals, und leider auch bei Denis Johnsons wunderbarem Band »Jesusʼ Sohn. Das muß nicht an der Qualität der Geschichte liegen, sondern hat damit zu tun, was mich an einem Plot und der Konstruktion einer Erzählung fesselt und was weniger. Sozusagen auf einer ganz intuitiven Ebene: das, was Schlegel in seiner bitte unbedingt wieder zu lesenden Schrift zum Studium der griechischen Poesie das Interessante nannte und was später, von der Jenaer Frühromantik ausgehend, eine zentrale Kategorie moderner Dichtung werden sollte, im Gegensatz zur nach bestimmten Regeln durchgebildeten Dichtkunst der Alten. (Obgleich man auch dieses Narrativ der Ästhetik anzweifeln kann.) Vielleicht ist es aber auch nur eine Wohnzimmerbequemlichkeit: es geht mir so, daß ich mich beim Lesen lieber in eine kontinuierliche Geschichte verstricke, gerne mit Umwegen und Ausbrüchen aus der linearen Ordnung und indem Zeitebenen durcheinander gehen. Bei Erzählungen verliere ich mich oft oder möchte bei einer einzigen Geschichte verharren und wissen, wie es weitergeht oder was man hinzudichten kann – oft sind Erzählungen, auch wenn sie zu Ende sind, für mich noch gar nicht zu Ende. In diesem Sinne bin ich kein guter Leser für Erzählungen. War ich noch nie. Einzig im Märchenbuch früher, Bechsteins Märchen, da las ich eine Geschichte nach der anderen weg – Fraktur übrigens –, verschlang sie und freute mich ob des Jammers oder auch der Erlösung. Vielleicht müssen wir uns Alban Nikolai Herbsts Erzählungsband »Wanderer wie ein Märchen vorstellen. Aber eben ein solches, wo eine Geschichte mit der anderen vielleicht kommuniziert und zusammenhängen könnte, ähnlich wie in der gleichnamigen Erzählung »Wanderer, wo ein eigenes Leben mit dem anderen eigenen Leben verquickt ist, weil da der Protagonist aus seiner eigenen Lebenswelt herausfällt und in der Decke in einer Anders- und Parallelwelt verschwindet. Gleich der eigenen Welt, aber doch nicht gleich und um ein winziges verrückt. Nun sind 2019 im Septime Verlag zwei Bände mit Erzählungen erscheinen: im Frühjahr 2019 »Wanderer und im Herbst 2019 »Wölfinnen – davon ich über den ersten Band hier schreiben werde. Trefflich vor allem, daß in dem Wanderer-Band frühe und teils auch unveröffentlichte Prosa zu lesen ist. Welcher Autor macht sich die Mühe, solche teils über vierzig Jahre zurückliegenden Texte noch einmal sich vorzunehmen, zu überarbeiten und zu redigieren? Und jeder, der einmal in jungen Jahren schrieb, weiß, daß da auch Ausschuß bei ist und der Wille zum Neuen manchmal vom Überschwang des Ausdrucks des Künstlers als junger Gefühlshund überlagert wird. Der Autor versucht, probiert, macht Experimente mit der Form und dem Inhalt. So auch bei Alban Nikolai Herbst. Doch beileibe sind diese Texte keine Jugendsünden – zumindest nicht in der hier dargereichten Form Die frühen, freilich überarbeiteten Erzählungen lesen sich insofern gut, weil sie souverän gearbeitet sind. Dabei es mir die erste Geschichte »Svenja, »Die Orgelpfeifen von Flandern und »Die Sache mit Kark Jonas, die dann später zu dem Roman »Der Wolpertinger oder Das Blau« umgeformt wurde, besonders angetan haben. Dazu später mehr. Der Neugierige freilich hätte gerne neben der letzten Fassung auch die frühere, die erste Version einer Erzählung sich gelegt, um zu schauen, wie ANH in Jugendjahren schrieb und tickte und was am Stil sich änderte. Andererseits aber sollte solche Neugier, ja Voyeurismus gar, nur etwas für den forschenden Germanisten sein und nicht für die lustvollen Leser, der am Interessanten wie am regelmäßigen Unregelmäßigen sich delektiert. Davon einmal abgesehen, daß solche philologischen, textkritischen Ausgaben kaum zu finanzieren sind und sich – verständlicherweise – nicht jeder Autor gerne in seine Werkstatt gucken läßt: wer gibt schon den Blick frei in die Experimentierküche der frühen wilden wunderbaren Jahre? Der Kritiker und der lustvolle Leser, der immer auch und zugleich im Kritiker stecken muß, will am Ende die fertige Prosa lesen – beim Literaturwissenschaftler mag es anders sein. Und solche Prosa haben wir in diesem Falle auch. Denn Herbst hat an seinen frühen Texten gefeilt und gearbeitet. Alban Nikolai Herbst ist ein umtriebiger Autor. Zahlreich sind seine Romane und auch die Gedichte und hoch seine Produktivität, was man bereits daran sehen kann, mit welcher Intensität und welchem ästhetischem Furor der Autor seinen literarischen Blog »Die Dschungel. Anderswelt betreibt. Wohl kaum ein deutschsprachiger Gegenwartsautor läßt seine Leserinnen und Leser derart an seinem Schaffen, seinem Leben, seiner Literatur teilnehmen, läßt sich in die Karten schauen beim Überarbeiten von Gedichten, wenn eine bessere und neue Version entsteht. Was ist produzierender Autor, was ist Text, was gehört zur Literatur, was zum Ich? Gehören womöglich auch die Stufen der Überarbeitung und der Schwund zur Literatur? Wenn man sich die Hölderlin-Ausgabe des Stroemfeld Verlags ansieht, ist das Fragment als ständige Umschrift und nie endender Prozeß von Überschreibungen das eigentliche Werk. Die Unterscheidung etwa zwischen Werk und Beiwerk, Autor und Romanfiguren, wie wir sie in jenen Erzählungen »Geständnis für die literarische Welt »Der Gräfenberg-Club finden, die Differenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit sind nicht grundsätzlich getilgt, aber doch in einer Weise verschoben, ja aufgehoben, daß in die Realität eine Nebenwelt, eine Anderswelt eben, einbricht. Der Begriff der Aufhebung paßt: so in der Geschichte »Joachim Zilts‘ Verirrungen. Wandern zwischen den Welten, wenn da jener Protagonist plötzlich im Schlafzimmer, in dem er vorher noch mit seiner Freundin lag, in einer Art Krater in der Wand, in einem Dübel-Loch in der Decke aus Neugier hineinkriecht und verschwindet und damit in eine Welt aus Gangsystem und Abweichungen hineingezogen wird, in Parallelwelten wieder auftaucht, die sein Leben sind, die aber doch nicht identisch mit seiner alten Lebenswelt und seiner Existenz sind. Aus dem Schutzort des Bettes heraus geschieht zwar nicht die Verwandlung, aber doch eine Transformation und es fällt der Protagonist aus seinem gewöhnlichen Leben. Eine Art kybernetischer Realismus, wie Herbst es in seiner Poetik formuliert. In diesen labyrinthischen Gangsystemen, die ein Zurückfinden in seine alte und gewohnte Welt unmöglich machen, leben noch andere Menschenwesen, die es ebenfalls aus ihrer alten Lebensweise hinausschoß. Joachim Zilts scheint nicht der einzige zu sein, dem dies widerfährt. »Ich war aus dem letzten von mir beschrittenen Gang in eine Welt hinabgestürzt, die meiner nur analog war. Menschen werden in diesen Erzählungen in Anderswelten versetzt. Und ebenso verwischen sich die Figurationen und die Frage nach Autorschaft, so zum Beispiel in der Erzählung »Geständnis für die literarische Welt: der Autor Alban Nikolai Herbst ist nicht der Autor seiner Texte, sondern ein gewisser Hans Erich Deters schreibt diese Prosa und Lyrik, für die dann ein gewisser Alban Nikolai Herbst seinen Namen hergibt: der Autor ist nicht Herr im eigenen Haus. Deters nimmt dann auch weiterhin in Herbsts Werk eine zentrale Rolle ein. Und bereits der Titel des literarischen Weblogs »Dschungel.Anderswelt spielt, neben der Assonanz auf den von Herbst geschätzten Dichter Rudyard Kipling, mit solchen Wucherungen, und es heißt dort auf der Seite: »Das Literarische Weblog. Erschaffen 2003/04 von den Fiktionären Herbst & Deters. In dem Roman »Wolpertinger oder Das Blau« tritt ebenfalls ein Hans Erich Deters auf. Man könnte dieses Buch einen postmodernen Roman nennen, so wie überhaupt das Schreiben von Herbst unter diesen Begriff fallen mag: Figuren nämlich, die immer wieder im Werk des Autors auftauchen, ein Autor, der Figur ist und wo Inszenierung und Leben nicht mehr trennscharf sind – so auch in seinem Blog. Allein, es greifen solche Klassifizierungen dann auch wieder zu kurz, weil sie das Spezifische der Prosa tilgen. Eben dem Eigensinn von Dichtung zuwider sind. Es läßt sich diese besondere Prosa auf keinen Begriff bringen. Immerhin: ein Autor von über sechzig Jahren. Herbst schreibt den Realismus, aber in diese Welt des Realen bricht immer wieder die Seltsamkeit herein, so in »Die Sache mit Kark Jonas, wo abends in den Gassen der Altstadt ein junger Mann, ein Ich-Erzähler mit einem Bettler ins Gespräch kommt und diesen in eine Kneipe einlädt. Der Bettler fabuliert, die Situation gerät seltsam, immer seltsamer und der Alltag aus den Fugen. Solche Erzählungen sind von einem surrealistischen Moment gespeist; daß da unter der Realität der gemütlichen Altstadt mit den romantischen Mauern noch was anderes dräut. Da setzt plötzlich die Zeit aus, als der junge Mann den Bettler angreift und schlägt und der Bettler ins Messer des Mannes fällt oder aber, daß der Mann das Messer in den Bettler stößt. Eine seltsame Frau taucht auf, eine Initiationsgeschichte, die was mit Körperlichkeit zu tun hat, ein normaler Alltag an einem Abend in einer Kneipe, wo einen zuweilen ein Gast zuquatscht, wird atmosphärisch aufgeladen, gerät aus den Fugen, fällt aus dem Lauf unserer Normalzeit und durch die seltsame Geschichte des Bettlers gelangt eine andere Ebene ins Erzählspiel. Herbst transformiert das konventionelle Erzählen, bringt es in eine andere Sphäre und verbindet die unterschiedlichen Ebenen. Wenn man es vergleichend klassifizieren wollte, was nicht zielführend ist, weil dies, siehe oben, den Eigensinn von Literatur raubt, aber deshalb vielleicht doch sinnvoll, weil sich der zunächst unwissende Leser auf diese Weise ein Bild zu machen vermag, könnte man hier Namen wie Italo Calvino und Jorge Louis Borges und den sogenannten magischen Realismus nennen. In den späteren Erzählungen des »Wanderer-Bandes dann findet sich vermehrt das Spiel mit den Realitäten, so in »Azreds Buch, »Der Gräfenberg-Club oder »Geständnis für die literarische Welt. Elemente eines fantastischen Realismus durchziehen viele der Erzählungen. Herbst spricht auch vom kybernetischen Realismus, was ich von der Begrifflichkeit passend finde, um diese fürs Deutsche her ungewöhnliche Prosa zumindest zu beschreiben. Sofern solche doxographischen Kategorien wie postmodernes Erzählen hier in Anschlag gebracht werden können, scheinen sie eine Tendenz dieser Literatur zu treffen. Zumindest aber, das bleibt festzuhalten, beschreiben sie Herbst Art des Erzählens in dem Sinne, daß die herkömmlichen Formen des realistischen Erzählens aufgebrochen werden: nicht zugunsten von Wunderwesen oder andershumanen Existenzen: es gibt keine Einhörner, Cyborgs und Oger, aber doch, daß da eine andere Ebene ins Spiel gerät: eine Phantastik. Wie wenn wir träumen. Wenn man es so sagen will, kann man Herbsts Prosa als eine Fortschreibung etwa von Louis Aragons »Le Paysan de Paris« lesen: auch dort bricht in die Szenerien der Stadt immer wieder eine andere Welt ein, wenn etwa unter dem Pflaster von Paris der Mythos brodelt und dort das Unbewußte nistet, die Statuen des Parks Buttes-Chaumonts etwa führen ein Eigenleben: Sie reden, sie erzählen. Ja, sie leben. In Aragons Roman heißt es: »Ein Gegenstand konnte sich vor meinen Augen verklären, ohne allegorische Züge noch Symbolcharakter anzunehmen; er manifestierte weniger eine Idee als er selbst diese Idee war.« Bei Herbst gesellt sich zur ästhetisch-erzählerischen Verklärung noch die Transformation hinzu. In diesem Sinne lese ich diese Prosa Herbsts auch in der Tradition von Aragon und dieser Art des Surrealismus, unsere Welt neu zu beleben. Das eben, was alle ästhetisch gelungene Literatur will. Verzaubern und entzaubern. Der Mythos ist Aufklärung. In vielen dieser Geschichte spielt der Tod eine Rolle (Gehirn, Der Sieg, Joana. Nachtstück, Der letzte Wille, Der Ton, Roses Triumph, Joachim Zilts Verirrungen) bis hin zu den Phantasien zum Selbstmord (Müder Gegner), kulminierend in der letzten Erzählung des Bandes, der wunderbaren, traumschönen, liebesseltsame Prosa »Die Orgelpfeifen von Flandern«. Ein Zeitrückblick, eine Recherche und der Abschied von einer Frau. Allein für diese Erzählung, der man eine eigene Rezension widmen muß, lohnt der Kauf dieses Buches. Allerdings: Ich fand beim Lesen nicht alle Erzählungen gleichermaßen gelungen und interessant. Bei jenen Erzählungen, die in Slang oder Mundart geschrieben wurden – sicherlich: ein Formexperiment auch –, schaltete ich ab, etwa bei »Marlboro, auf die ich mich vom Titel her gefreut hatte, weil sie nach Rauchen, nach Pferden und den 1980er Jahren klang, und auch bei der vom Stoff her eigentlich spannenden Erzählung »Schluß machen mit denen«: mir fehlte in dieser Intensität des Dialekts, der als Stilmittel das Extrem dieser Ich-Perspektive zeigt und insofern ästhetisch sicherlich konsequent verwendet wurde, das Wechsel im Ton. Vielleicht muß man sich die Erzählung »Marlboro« vorgelesen vorstellen, denn Herbsts Prosa lebt, wie eigentlich jede gute Literatur, vom Klang. Dichtung ist immer auch Musik. ANHs Dichtung besonders. Ich verstehe das Formexperiment, das für diese frühen Erzählungen eine zentrale Rolle spielt und eine teils saturierte Ich-Erzählzeit der damals grassierenden Neuen Subjektivität implizit kritisiert, die sich heute im autobiographischen Schreiben wiederholt oder zumindest darauf rekurriert. Und in diesem Sinne sind Herbsts Romane wie auch dieser Erzählungsband eine wichtige Kritik jener Knausgardisierung der Literatur. Daß das Ich ein Ich und zugleich immer eine Fiktion ist. Sich wandelnd, und zwar derart, daß es nicht einfach von sich erzählt, sondern zu fabulieren beginnt. Dichter sind Phantasten. Herbst scheut das Experiment nicht. Er spielt mit den Stilen, setzt sie je nach Sujet und Geschichte unterschiedlich ein. Insofern ist dieses Jonglieren in den unterschiedlichen Erzählungen und damit die Abweichungen in der Form sowie das Variieren des Stils nicht Beliebigkeit, sondern es bedingt der Inhalt die Form und die Form wiederum wirkt auf den Inhalt, was ein neugieriger Betrachter vermutlich wird verifizieren können, wenn er sich in die Werkstatt des Autors schliche, sich die Schritte betrachtete, in denen diese Erzählungen je überarbeitet wurden. Auch ein manchmal hoher Ton kommt vor. Da Herbst aber Pathos – ganz zu recht übrigens – nicht als Schwundform des Literarischen und auch nicht als Kitsch betrachtet, sondern dieses Pathos der Dichtung wesentlich ist – seltsames Ding auch: was beim Pop gerne toleriert wird, wenn Menschen beim Klammerblues schwelgen und fummeln und in Rückreflexion sehnsüchtig werden, wenn sie daran denken, wie die Fingerspitze an der Poritze glitt und wenn sie sentimental durch den Song fingerten, wie sie es tun sollen: all das wird von den selben Menschen, die dieses Pathos in der Musik und beim nachträglichen Denken übers Fummeln schätzen, in der Literatur verpönt – insofern scheut sich Herbst nicht, diese Pathos einzusetzen und einen ganz eigenen, auch hohen Ton anzuschlagen oder Wortwendungen zu wählen, die wie aus der Zeit gefallen scheinen »Wie ihre Kehle hüpft« – zumindest aber lesen wir bei den frühen Erzählungen schon eine Sprache, die im Polit-Sound der frühen 1970er Jahre seltsam wirkte. Der Anfang der ersten Erzählung bereits spielt nicht nur mit dieser Tonlage, sondern erzeugt in der Sprache und ihrer Anordnung eine nicht nur besondere Atmosphäre der Verklärung, sondern schon optisch und im Lesefluß einen Bruch:
»Elfenkönigin seine »schon als sie zum ersten Mal vor ihm steht: im Halbprofil schräg jemandem andres zuwendet. Wie sehnig sie ist und wie schmal! Ihr durchgedrücktes Hohlkreuz. Ihre sehr kleine Brüste. So in »Svenja« dieser Eindruck und diese Körperbeschreibung und Geste, die im Anfang und am Ende für eine Liebe verantwortlich ist: daß da was funkt. Im Ton, denkt sich der Leser zunächst, ist das eigenwillig geschrieben, in einem besonderen Sprachstil und für einen vielleicht 17jährigen Autor ungewöhnlich. Die Erzählung ist um 1972 entstanden, auf Schreibmaschine getippt, mehrfach umgearbeitet, wie man der Quellenangabe am Ende des Bandes entnehmen kann. Insbesondere wenn man die politischen Tendenzen jener frühen 1970er Jahre bedenkt, taucht da eine andere Art von Erzählen auf – die Geschichte ist im Stil so anders gehalten als jene bereits aufkeimende Innerlichkeitsprosa der frühen 1970er Jahre, und sie hat nichts von den Post-68er-Politpossen, die entweder die Befindlichkeiten gescheiterter Revolten ausrollen oder aber die Literatur am liebsten gleich ganz abschaffen wollten. Die klugen Autoren wie Handke und Bernhard, aber auch Frisch und Johnson wußten um solche Tücken und machten sich im Schreiben mit dem unmittelbar Politischen nur bedingt gemein. Der Stil ist teils lyrisch, doch gerade durch dieses Mittel bleiben die Charaktere im Kopf des Lesers hängen und werden plastisch: jenes Mädchen Svenja, das gerade mal der Pubertät entwachsen ist und jener junge Mann, der sie anscheinend begehrt, der seine erste Liebe liebt und darin vielleicht mehr noch die Liebe als jene Svenja – aber auch das gehört vermutlich zum Lieben – und der sie gerade deshalb grandios verfehlt. Eine schöne Geschichte vom Scheitern und sie korrespondiert vor allem wunderbar mit jener oben genannten letzten und tieftraurigen Erzählung »Die Orgelpfeifen von Flandern«. Sie bildet den Abschluß und die Klammer zur Erzählung »Svenja und auch den Höhepunkt dieses Bandes. Erzählungen sind insofern ein eigenes Genre, weil es hier leichter möglich ist zu sehen, wie ein Autor, hier Herbst, den Stil und den Ton der Texte immer wieder variiert. Man kann diesen Wechsel der Töne auch, wie uns Joyces »Ulysses demonstrierte, in einem einzigen Roman machen, aber in den Erzählungen zeigt sich das insofern angenehmer, da die unterschiedlichen Sujets und Erzählsituationen unterschiedliche Stile motivieren. In diesem Sinne lese ich diesen ersten Band als einen Blick in die Werkstatt des Autors – einerseits – und andererseits eben finden wir eigenständige und als gelungene Literatur sich bewährende Prosa, der ich viele Leser wünsche. Ob die Erzählungen einen guten Einstieg bieten, um in Alban Nikolai Herbsts Werk hineinzugelangen? Ich weiß es nicht. Ich denke, man sollte schon ein wenig mehr von Herbst gelesen haben, um in dieses Labor aus Form, Formwille, neuem Stil und metaphysisch-existenzieller Versuchsanordnung den Weg zu finden. Oder doch nicht? Vielleicht bietet gerade der »Wanderer-Band einen guten Überblick, etwa mit der Svenja-Erzählung wie auch den Orgelpfeifen und der Sabinenliebe und insbesondere die Erzählung »Roses Triumph liefert ein herrliches, trauriges und zugleich saukomisches melvillesches Bartleby-Motiv: fatale Dialektik von Freiheit: plötzlich und wie auf einen Schlag zu wissen, daß man frei ist, wie eben jener Herr Rose, jene mediokre Angestelltenexistenz, die auch wir sind, und diese ungeheure Erkenntnis doch für sich zu behalten, ohne praktische Konsequenz, niemandem sie zu sagen, in sich hineinschmunzelnd, schweigend und in seiner Büroexistenz immer weiter machend und harrend, weil Rose ja wußte, daß er frei war und also gar nicht aufzuhören brauchte, bis zum Ende. Auch eine dieser herrlichen Herbst-Erzählungen. »Äußerte sich nicht die vielleicht perfideste Freiheit gerade darin, daß er – sitzen blieb? Wenn er sich weiterhin nichts anmerken ließ? Die Vorstellung, eine Frau, mit der er über zweieinhalb Jahrzehnte verbracht hatte und die deshalb nicht völlig grundlos annehmen durfte, ihn zu kennen – eine solche Frau derart zu täuschen, begeisterte ihn. Er lachte auf. Gepaart ist dieses Spiel mit jenem Motiv aus Nathaniel Hawthorne Erzählung »Wakefield« das Leben der anderen zu beobachten, nur daß jener Rose, anders als in »Wakefield«, nicht aus dem Verborgenen, aus dem gegenüberliegenden verlassenen Haus das Leben seiner Ehefrau und seiner Familie beobachtet, nachdem er nach einem Spaziergang niemals wiederkehrte, sondern Rose ist live dabei und doch sich verstellend. Selbst das Alter und den Verfall simuliert er noch – klar bei Geist und die anderen taxierend. Ich bin mir nicht schlüssig, ob ich diesen Band mit Erzählungen als Einstieg empfehlen würde. Ja, ich begänne beim Herbst-Lesen und -Entdecken mit anderen Büchern. Wenn es aber darum ginge, einen Einstiegstext für jene zu finden, die bisher ihn nicht gelesen haben, so empfehle ich die wunderbare »Sizilianische Reise«, den flirrenden Süden aus Mythos, Zeit und Erzählung, in der ebenfalls zahlreiche Elemente und Motive, die auch in seinen Erzählungen auftauchen, Eingang finden: insbesondere die Frage nach der Realität und der Fiktion. Oder für jene Melancholiker seinen Roman »Traumschiff« zart und poetisch reisen wir mit dem Protagonisten auf seiner Todesreise über den Ozean und hinüber in jene andere oder aber Gar-nicht-Welt – je nachdem, wie wir religiös gestimmt sind. Wer aber einen Einstieg finden will in die Leidenschaft der Kunst, des wilden Liebens und des wunderbaren Lebens, der lese unbedingt »Meere«: »Fichte hat nie sublimieren wollen. Immer das Leben direkt. Daher dieses öffentliche Missverständnis über seine Kunst. Es geht ihr nicht darum, ein Manko zu beheben. Sie will das Manko sein. Will es auf eine Weise sein, die es erzwingt, die gar nichts anderes möglich macht, als Lust aus ihm zu ziehen. Sie soll Welt sein.
Fichte, das ist nicht nur Kiefer, sondern das unreine Ich und Tathandlung.
Lebenswild, schaffend, Dionysos, Apollon und unsere so moderne Moderne, die
dieser Roman schildert und persifliert in einem. Das aber wieder ist ein anderes
Thema. |
Alban Nikolai
Herbst |
|
|
|
||