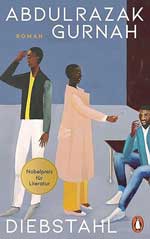|
Der Erzähler entführt
seine Leser in die Welt Ostafrikas von Anfang der 1980er Jahre bis in die
heutige Zeit. Anhand von drei exemplarischen Biografien und ihrer Hintergründe
zeigt er den Wandel des alten Afrikas mit seinen ländlichen Produktionsweisen
und Orientierungen, den Großfamilien und traditionellen Sitten hin zu einem
modernen und internationalen Staat, dessen Lebensverhältnisse sich denen von
überall auf der Welt anähneln.
In den ersten beiden Teilen werden drei Geschichten länger erzählt. Der
Protagonist Karim stammt aus der tansanischen Mittelschicht. Er liest viel,
bekommt die Gelegenheit zum Studium an einer einheimischen Universität und wird
bald ein technischer Experte in der Baubranche. Er hat Kontakte zu Europäern und
bringt es am Ende vielleicht sogar zum Minister, so genau erfährt man es nicht.
Auf jeden Fall wird er, je mehr er in die Welt der NGOs, der internationalen
Hilfsorganisationen und ihrer Experten sowie in die bis nach Europa reichenden
politischen Kontakte hineinwächst, heimgesucht auch von der Krankheit der
Europäer: der modernen Nervosität, Ungeduld und der Unleidlichkeit bis hin zum
Zorn, den er an seinem Kind auslässt und an seiner Frau.
Seine spätere Frau Fauzia stammt ebenfalls aus der unteren Mittelschicht und
wird als Kind von epileptischen Anfällen geplagt. Ihre überfürsorgliche Mutter
gibt diesen Charakterzug an ihre Tochter weiter. Eine untadelige biologische
Gesundheit ist bei Frauen wichtig für ihre Heiratsfähigkeit und das
Kinderkriegen: Vererbt sich die Krankheit weiter oder nicht? geht ihr und der
Mutter anscheinend unablässig durch den Kopf. Es gelingt ihr aber, davon
freizukommen, ebenfalls zu studieren und ihrem Traumberuf als Lehrerin in
Sansibar nachzugehen. Sie ist eine Intellektuelle, die ihr eigenes Leben lebt.
Auch hier spielen wieder die Bücher, die sie lesen kann und die sie verschlingt,
eine wichtige Rolle.
Die dritte Figur des Buches ist Badar, ein entfernter Verwandter Karims, dessen
Vater durch einen Diebstahl seine Linie innerhalb des größeren Clans in
Misskredit gebracht hat. Er wächst als Gehilfe bei einem Onkel auf und als ein
Diebstahl passiert, wird dieser ihm in die Schuhe geschoben. Als sich
herausstellt, dass er nichts damit zu tun hat, hilft ihm das nicht; er wird
dennoch als natürlicher Täter angesehen. Immerhin nimmt ihn Karim mit nach
Sansibar, er kann bei seiner Frau Fauzia und ihm wohnen und er besorgt ihm über
Beziehungen einen Job als Angestellter eines Hotels.
Der dritte Teil des Romans schließlich spitzt die Verhältnisse zwischen den
dreien in Sansibar zu. Die beiden jungen Männer Karim und Badar sind
verschieden. Ihr freundschaftliches Verhältnis wird durchaus als Hierarchie
geschildert. Wo der eine ein Aufsteiger ist, der in Europa arbeiten kann, da ist
der andere die meiste Zeit damit beschäftigt, die Familienschande abzuschütteln,
die wie ein Damoklesschwert über ihm schwebt. Für ihn ist es bereits ein
Fortschritt, die feudalen Verhältnisse als Diener zu überwinden, um einer
Lohnarbeit nachzugehen, mit der er sein eigenes Geld verdienen kann. Langsam und
stetig arbeitet er sich mit einer Mischung aus Klugheit und Geduld aus den
einfachen Verhältnissen heraus. Das gilt auch für seine Gefühlsökonomie. Er
behält seine Verliebtheit für Karims Mutter und später für Fauzia für sich,
zeigt aber auch Züge von Voyeurismus. Zum Schluss wird er, der eigentliche Held
des Buches, für seine Kantische Lebensweise belohnt, während Karim mit seiner
Nietzscheanischen Freiheitsvorstellung dem Paradigma des Machtmenschen und
nervösen Europäers anheimfällt.
Die Frauenfiguren bewegen sich in diesem Roman auf ihre eigene Weise zwischen
Moderne und Tradition. Dadurch, dass sie Kinder bekommen, ist ihre
Unabhängigkeit begrenzt. Aber auch ihnen steht es gegen Ende des 20.
Jahrhunderts offen, bei Konflikten mit ihren Partnern zurück in ihre Familie zu
ziehen. Allerdings handelt es sich dabei nicht mehr um eine afrikanische
Großfamilie. Der Übergang zur modernen Gesellschaft und zur dreiköpfigen
Kleinfamilie schlägt die Ostafrikaner wie gesagt neben den Freiheiten auch mit
den Unbillen der Moderne: Einsamkeit, existenzielle Not und Sinnlosigkeit des
Daseins beerben die Gewalt und Abhängigkeit der Kolonialzeit.
Der Wandel der Lebensverhältnisse in Tansania innerhalb der letzten 40 bis 50
Jahre spiegelt sich in diesem Epos wider. Gab es in den 1980er Jahren eine
überschaubare Zahl von weißen Touristen, die sich zum Kilimandscharo oder in die
großen Wildparks wie Ngorongoro oder Serengeti aufmachten, so wird in den
nächsten Jahrzehnten Sansibar von einem omanischen Sultanat zu einer
internationalen Ferieninsel umgerüstet. Die Touristen braten hier nun wie
überall in der Sonne, die vorher vermieden wurde; sie beklagen sich wie überall
über das Meer, das sich bei Ebbe zurückzieht und sie beschweren sich wie überall
– berechtigt oder nicht – über den in ihren Augen fehlenden Service der
Angestellten. Und sie suchen, Männer wie Frauen, kurze erotische
Urlaubsabenteuer bei den ach so exotischen Einheimischen, bevor sie wieder in
die alten Verhältnisse nach Europa zurückfliegen.
Gurnah registriert das alles mit einem großen Herzen für die Umstände und
Möglichkeiten seiner Figuren. Sein unbestechlicher Erzählton besitzt auf den
ersten Blick etwas neutral Chronologisches. Auf welcher Seite er wirklich steht,
aber merkt man an der Konstruktion des Romans. Es geht um zweierlei
exemplarische Verbrechen (vor einem Hintergrund der Korruption, der durchgängig
ist, aber in dem Buch nicht auffällt): Der Diebstahl, der in Badars Umgebung in
Daressalam passiert – ein Kaufmann schreibt für den Haushalt seiner Herren, für
den er einkauft, höhere Beträge an – wird unweigerlich ihm in die Schuhe
geschoben. Bei dem späteren Diebstahl in Stone Town auf Sansibar geht es um
Geld, das einer NGO-Angestellten aus ihrer Wohnung entwendet wird. Auch da wird
zunächst wieder ein Tansanier verdächtigt. Es stellt sich aber heraus, dass die
Mitbewohnerin, ebenfalls eine Expertin, sich das Geld „nur geborgt“ hat. Was für
den einen schicksalhaft das Leben verändert, ist für die andere eine Bagatelle.
Die junge Engländerin, mit der der Afrikaner eine Affäre begonnen hatte, fährt
nach einigen Wochen wieder nach Hause zurück. Aber die Ehe des Sansibari ist mit
Folgen für Frau und Kind für das ganze Leben beschädigt.
Es ist allerdings typisch für den Stil Gurnahs, dass der Ältere, der das Leid
verursacht hat, die Schuld in der Hierarchie an den Jüngeren weiterreicht, ohne
eine nötige Selbstkritik zu üben. Auch das sind europäische Verhältnisse einer
falschen Selbstgerechtigkeit, wenngleich man bei Kants Ethik der Pflicht etwas
anderes hätte lernen könnte. Karim ist Ingenieur, ob er Kant gelesen hat,
erfährt man nicht. Aber auch Kant selbst steht mit seiner Ethik zwischen der
doppeldeutigen Pflicht des Feudalismus und der ebenfalls gespaltenen Freiheit
des neuen Marktes. Die junge schöne Engländerin hatte jedenfalls ihre Affäre mit
einem Schwarzen durchaus einvernehmlich. Das ist sicher keine überzogene
Geschichte, die Gurnah hier erzählt. Sie wird exemplarisch für die Situation der
jungen unabhängigen afrikanischen Staaten: Die Bürger sind der Tradition
verhaftet, sie nehmen aber nun an der Globalisierung nicht mehr als
Kolonialisierte, sondern auf der Basis von Verträgen teil. Ausbaden müssen diese
Verhältnisse so oder so wie überall sonst auch die Frauen. Und so singt zwar
Fauzias Mutter Khadija ein Klagelied über die Touristinnen und die wazungu
und über die „seltene Blume Männertreu“. Ihre Tochter aber hat durchaus
Verständnis für das Verhalten ihres Mannes. Jedenfalls lässt sie auf die
modernen Verhältnisse nichts kommen. (S.
307-308)
Zurück zur repressiven Tradition des Kolonialismus und des Kalifats führt
jedenfalls in diesem Roman kein begehbarer Weg. Afrikanisch-arabischer
Fundamentalismus, der real nicht nur die ostafrikanischen Staaten bewegt, hat in
Gurnahs Szenario keine Chance. Eher schon steht hier ein traditioneller
afrikanischer Sozialismus, die Ujama-Gesellschaft, Pate, der seinen Weg
durch die Globalisierung hindurchnimmt – und sei es nur in Gestalt der Bücher,
die gelesen werden und im Leuchten der Augen der Protagonisten. Dieses blitzt
immer dann auf, wenn ihnen etwas Interessantes passiert, in dem ihr eigenes
Interesse mit dem öffentlichen zusammengeht.
Am Ende geht für alle das Leben weiter. Vier Jahre gehen ins Land. Badar macht
sich seine eigenen Gedanken über die schöne Engländerin. Erst jetzt betrachtet
er ihre Straße, die fiktive Gemstone Street im Londoner Stadtteil Camden in
Google Earth und macht sich Gedanken wie ETA Hoffmann in seiner Novelle Des
Vetters Eckfenster, er spekuliert darüber, was hinter den Londoner
Hausfassaden stecken könnte. Er imaginiert sich den Freund oder Ehemann, zu dem
sie nach ihrem Abenteuer zurückgekehrt sein mag.
Und damit ist auch Gurnahs Erzählung in der Moderne angekommen: Schreibe nicht
wie es gewesen ist, sondern wie du es erinnerst, rät André Gide einem Autor. Die
Wirklichkeit, die Gurnah beschreibt, lebt von dieser Vermischung von äußerer und
innerer Realität. Gurnah ist ein sanfter phantastischer Realist und der Leser
hat es schwer zu sagen, welcher Seite seiner Natur der Hauptakzent zukommt – dem
apollinisch gehaltenen Traum oder der schockierenden äußeren Welt und ihren
Gesetzen des Realitätsprinzips. Der Sansibari ist ein großer epischer Erzähler.
Seine Geschichten gleichen auf diese Weise den Romanen von Halldór Laxness, dem
isländischen Nobelpreisträger. Das Verbindende zwischen beiden überwiegt, ohne
dass die Differenzen klein geredet werden würden. Damit ist es unerheblich, wo
genau die Geschichten spielen, sei es in Sansibar oder in Reykjavik.
Weltliteratur ist nach Goethe das Apriori einer scheinbar fremden Kultur in der
eigenen. Das hat nichts Magisches, Gurnah ist umfassend gebildet, er wird
Laxness gelesen haben.
Doch zurück nach Sansibar und den Protagonisten: Am Ende kommen in Gurnahs
Geschichte dann doch der treue Badar und die schöne und intellektuelle Fauzia
zusammen. Das beruhigt den Leser, denn ihre Tochter Nasra mochte den Onkel schon
immer lieber als den leiblichen Vater. Das Buch jedenfalls ist beeindruckend. Es
entführt die Leserinnen und Leser in eine andere afrikanische Welt, die doch so
anders nicht ist als ihre eigene: die Probleme der Menschen bleiben die
gleichen. Es geht um Liebe, Diebstahl, Verrat, Korruption und so oder so um die
Folgen des Kolonialismus. Aus einer solchen Lektüre kann man manchmal sehr viel
mehr lernen, als wenn man in das Land gereist wäre.
Artikel online seit
08.11.25
|
Abdulrazak Gurnah
Diebstahl
Aus dem Englischen
von Eva Bonné
Penguin Verlag
336 Seiten
26,00 €
978-3-328-60438-9
|