  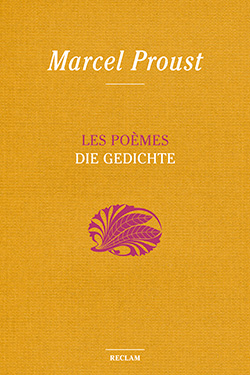   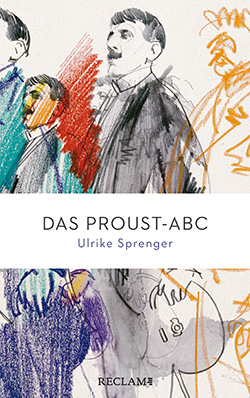 |
||
|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
||
|
Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |
||
|
|
||
|
|
Im
dauernden Augenblick |
|
|
Lange Zeit bin ich Proust ausgewichen. Als 1984 Volker Schlöndorffs Verfilmung »Eine Liebe von Swann« in die Kinos kam, fing ich mit Prousts »Recherche« an und brach sogleich nach den ersten 30 Seiten die Lektüre ab, denn die mäandernden Sätze trafen nicht, und Einschlafprobleme, von denen mein lesendes Ich als Schüler nichts wissen wollte, waren kaum zum Lesen angetan; sie schlugen auch im Sinne der von mir präferierten Ästhetik nicht ein. Und so schweiften meine Gedanken beim Lesen ab. Welch seltsamer Zustand im Zwischenreich wurde da beschrieben, und es tat sich eine eigentümlich Atmosphäre in dem fiktiven Ort Combray auf, wie als hörte ich ein Debussy-Stück wie »Pelléas et Mélisande«, symbolisch verhangen, flirrend die Atmosphäre, wie als läge der Duft schwerer Parfums und dichter Brokatvorhänge in der Luft und es träte sogleich die frisch erblühte Tochter der Kameliendame in die gute Stube. Es roch nach dem Interieur der Belle Époque und eine Duftigkeit strömte da im Text, die nichts mit allem bisher Gelesenen zu tun hatte: wie aus dem Reich der Lotophagen kam diese mir fremde Stimmung herüber, und mich, der ich Kafka, Jünger, Benn, Sartre, Brecht, Döblin las – der trockene Ton der Morgue, die kristalline Moderne samt den Verzückungsspitzen ästhetischer Kälte, für die die Jugend meist als empfänglich sich erweist – verstörte und es langweilte diese in meinen Augen seltsame Atmosphäre, so wie ich auch mit der Malerei Gustave Moreaus damals wenig anfangen konnte. Ich goutiere ihn erst, als ich im Herbst 1985 in Paris vor seinen Bildern stand. Ich war damals für Proust nicht bereit. Das war die ganze Wahrheit; und wie es mit dem Buch und dem Kopf ist, wenn sie zusammenstoßen, so hat das oftmals wenig mit dem Buch und viel mit dem Kopf zu tun, der ein Buch nicht zu fassen vermag. Ein paar Jahre später fing ich noch einmal mit dem Lesen an. Nun mit einem reiferen Bewusstsein. Und es war diesmal alles ganz anders. Eine Prosa las ich da, die mich aufnahm und aufsog und die mich fortan mit ihren sieben Bänden für einige Wochen nicht mehr loslassen sollte. Was sich in jener Proustschen Suche zuträgt, lässt sich nicht einfach in Worte oder gar in eine Inhaltsangabe fassen: zu schweifend der Text und so unterschiedliche Zonen berührend wie Natur, Gesellschaft, Wahrnehmung, Erinnern, Zeit, Liebe, Kunst sowie die Lebensformen einer bestimmten adeligen, bürgerlichen und großbürgerlichen Klasse – die kleinen Leute kamen allenfalls als Personal vor, so wie die Haushälterin Françoise; aber auch solches Fehlen von Elend – Proust ist nicht Hugo, nicht Zola – sagt etwas aus und beschreibt die Härten einer Gesellschaft. Wollte man, wenn man es denn könnte, Prousts »Recherche« in wenige Sätze bringen, so ließe sich konstatieren, dass es die Zeit des Fin de siècle ist, eine Zeit des Umbruchs und der technischen Neuerungen: vom Automobil bis zur Photographie, die für die »Recherche« eine zentrale Rolle spielt. Und es ist zudem – als dieses siecle 1914 endete – eine Zeit des Wandels durch den Großen Krieg, die Proust schildert; wir lesen von einer heraufziehenden Moderne und wie sich Gesellschaft und Menschen ändern. Und wir beobachten vor allem einen Ich-Erzähler beim Beobachten. Solches Herausschälen des Schriftstellers aus dem Geist des Wahrnehmens finden wir bereits an zahlreichen Stellen im ersten Teil, in »Unterwegs zu Swann«, so etwa wenn der Jugendliche beim Spazieren mit seinen Eltern in der Gegend von Combray auf sich und auf sein Beobachten blickt: »Wieviel betrübender noch als zuvor schien es mir seit jenem Tag auf meinen Spaziergängen in die Gegend von Guermantes, daß ich keine Begabung fürs Schreiben besaß und darauf verzichten mußte, je ein berühmter Schriftsteller zu werden. Das Bedauern, das ich darüber empfand, während ich allein und abseits träumte, machte mich so niedergeschlagen, daß mein Geist, damit ich es weniger fühlte, von sich aus in einer Art von Zurückweichen vor dem Schmerz ganz und gar vermied, bei dem Gedanken an Verse, Romane oder an eine Dichterzukunft zu verweilen, mit denen ich offensichtlich aus Mangel an Talent nicht würde rechnen können.« Wir sehen an dieser Stelle jenen Wunsch, all die Details, die der noch jugendliche Erzähler sieht, auf einen Begriff zu bringen. Das freilich, was an dieser Stelle erzählt wird, ist keine präsentistische Darstellung einer Jetztzeit, sondern ein Imperfekt und wird alles von einem weit von dieser Spazierszene zurückliegenden Zeitpunkt aus reflektiert, denn einige Seiten später heißt es: »So dachte ich oft bis zum Morgen an die Zeiten von Combray zurück, an meine traurigen schlaflosen Abende, an viele Tage auch, deren Bild mir viel später erst durch den Geschmack – das ‚Aroma‘ hätte man in Combray gesagt – einer Tasse Tee wiedergeschenkt worden war, …«. Zugleich sehen wir an dieser Stelle, wo der junge Mann über seine Begabungen nachdenkt und zugleich rückblickend auf sein Nachdenken schaut, das Unvermögen, das was erlebt wurde, angemessen darzustellen, so dass sich der damals noch junge Mann sogar noch das Denken an Verse und Romane versagt. Doch dann geschieht ein Bruch, wo plötzlich – unwillkürlich wie bei jener Tasse Tee und dem Gebäck – Erinnerung und gelebte Zeit lebendig werden und im Sinne einer Plötzlichkeit sich ein Wandel zuträgt, denn im direkten Anschluss an jene oben zitierte Spazierszene heißt es: »So nun, völlig außerhalb von jeder literarischen Absicht und ohne einen Gedanken daran, fühlte ich manchmal meine Aufmerksamkeit plötzlich gefangen von einem Dach, einem Sonnenreflex auf einem Stein, dem Geruch eines Weges, und zwar gewährten sie mir dabei ein spezielles Vergnügen, das wohl daher kam, daß sie aussahen, als hielten sie hinter dem, was ich sah, noch anderes verborgen, das sie mich zu suchen aufforderten und das ich trotz aller Bemühungen nicht zu entdecken vermochte. Da ich genau fühlte, daß es in ihnen war, blieb ich unbeweglich stehen, um sie anzuschauen, einzuatmen, um den Versuch zu machen, mit meinem Denken über das Bild oder über den Duft noch hinauszugelangen.« Die Dinge und Szenen enthalten ein Mehr, einen noch anderen Aspekt. Mehr als sie in jenem Augenblick sind. Das Spiel von Schein und Vorschein wird hier virulent. Dies aber geschieht nicht im Sinne einer metaphysischen Hinterwelt, sondern dass die Szene noch nicht genügend erfasst wurde. So vertiefen auch wir uns beim Lesen dieser Beobachtungen wie ein Mikroskopist in noch die feinsten Details. Es ist bei Proust eine Vivisektion, es sind Wahrnehmungsintensitäten, wie wir selbst sie in den seltensten Fällen auf den Begriff bringen, und wir sehen in der »Recherche« dem Schriftsteller bzw. jenem Ich dabei zu, wie es seine Fähigkeiten ausbildet. In solchem Blick kann sich ein Ich verlieren. Doch sollte man den Erzähler, der »ich« sagt, trotz des Namens Marcel nicht mit dem Autor Marcel verwechseln, wie Proust in seinen Essays »Aus dem Umkreis der Recherche« über sein eigenes Buch schreibt. Wenngleich es einige Parallelen gibt: Erzähler-Ich und Autor sind beide gleichermaßen gesundheitlich angeschlagen und hochsensibel – wie schon zum Auftakt der »Recherche« klar wird, wenn der kleine Marcel wegen des überraschenden Besuchs von Swann zu Bett geschickt wird, auf den zweiten Gute-Nacht-Kuss der Mutter verzichten muss und darunter entsetzlich leidet, so dass er nicht einschlafen kann und am Ende den Eltern des Abends auf der Treppe auflauert, um jenen zweiten Kuss zu ergattern: so wird der Leser in den Kosmos eines hochsensiblen Kindes geführt. All solche Regungen werden bis in die feinste Verästelung beschrieben – weniger freilich im Sinne eines Psychologismus, sondern vielmehr phänomenologisch: wie nämlich solche Empfindsamkeit sich ausprägt und seine Wege findet. Walter Benjamin schrieb als Lesewarnung zu Louis Aragons wunderbaren Roman »Paysan de Paris« 1935 an seinen Freund Adorno, dass er aus diesem Buch »des abends im Bett nie mehr als zwei bis drei Seiten lesen konnte, weil mein Herzklopfen dann so stark wurde, daß ich das Buch aus der Hand legen mußte.« Solche Überreizung ist verständlich und diese Vorsicht könnte auch für Proust gelten – nur hätte solches Leseverhalten den Nachteil, dass derart sorgsam gelesen ein Leben nicht mehr ausreichen würde, mit Prousts »Recherche« zum Ende zu gelangen. Und es würde solches Unterbrechen auch deshalb nicht gelingen, weil einen die Sätze Prousts forttragen – die Berührungspunkte freilich zu Aragons Surrealismus und seinem Mythos von Paris und dem Proustschen Paris wären ein interessanter Aspekt, den sich herauszuarbeiten lohnt. Wer dieser »Recherche« verfällt, findet sich angesichts von Prousts Sätzen im dauernden Augenblick, einer Art Sprachmeditation, ein nunc stans, einer auf den Punkt verdichteten und auch wieder unendlich dauernden Zeit, wenn der Leser sich in die Wörter, die Sätze, die Kaskaden und Szenen vertieft, etwa wenn über Seiten eine Landschaft beschrieben wird, und so sitzt der Leser plötzlich wie ein Gefangener im Kopf eines anderen, verfolgt dessen Gedanken, dessen Wahrnehmen und Empfinden: eine Weißdornhecke, die Blumen auf den Wiesen von Combray beim Spazieren des kleinen Marcel mit den Eltern, dieses Flirren von Licht, man könnte es mit dem Impressionismus vergleichen, aber das stimmt nicht: eher ist es die Malerei von Cezanne, in der die Dinge im sommerlichen Licht zerlegt und um ein Winziges versetzt werden, um in eine neue Ordnung zu gelangen. Ihre Perspektive wird nicht, wie im Kubismus, zertrümmert und aufgelöst, sondern vielmehr anders aufgefächert. Für dieses Neujustieren reicht bereits Alltägliches aus, wie etwa eine Weißdornhecke oder das Belauschen eines Gesprächs. Und dieses Ausfalten und Zerlegen geschieht mit der Natur wie auch mit all den Konversationen und Menschenbeobachtungen, mit der Liebe und der Eifersucht, dem Wahn, die Geliebte zu überwachen und zu besitzen: neben all der Ruhe und Schönheit finden sich in Prousts »Recherche« eben auch die Exzesse und der Sadismus. Proust ist ein großartiger Beschreiber solcher Alltäglichkeiten. Der erste Teil der »Recherche«, jene Welt der Kindheit in Combray ist von solcher noch eher lieblichen Beschreibung angefüllt; das reicht bis zu den Einkäufen für die Mahlzeiten und der Zubereitung von Mahlzeiten durch die Köchin und Haushälterin Françoise im Haus der Tante Léonie in Combray, all die Details vom Landleben, ein Nachmittagsspaziergang im Wald oder eine Kutschfahrt, und später dann die Welt der Salons und Plaudereien – mal Belangloses, mal aber auch die höchste Kunst der geistvollen Unterhaltung. Und immer wieder treffen wir auf die Natur und auf Parklandschaften. So heißt es von Combray und dem Gut der Swanns: »Durch die Hecke hindurch sah man im Innern des Parks einen Weg, der mit Jasmin, Stiefmütterchen und Verbenen eingefaßt war, zwischen denen Levkojen ihre taufrischen Täschchen in einem wie altes Korduanleder duftenden und etwas vergilbten Rosa öffneten, während auf dem Kiesweg ein langer grüngestrichener Gartenschlauch in vielen Windungen sich hinzog und aus seinen Öffnungen über den Blumen, deren Duft er durchfeuchtete, den senkrecht aufgestellten, als Prisma wirkenden Fächer seiner in allen Farben spielenden Tröpfchen aufsteigen ließ.« Der milde Glanz der Natur, ihr sommerlicher Duft, wenn der junge Erzähler durch die Flusslandschaft an der Vivonne streift: all das gelangt in den Bannkreis des Erzählens. Aber solche Schönheit der Natur, der Proust sein Schreiben widmet, ist nicht alles. Es gibt in der »Recherche« ebenfalls eine Ästhetik des Verfalls. Immer wieder bricht sich solches Vergehen der Dinge und der Menschen im Lauf und durch den Lauf der Zeit seine Bahn. So in der Betrachtung von Natur bei einem Herbstspaziergang in Paris im Bois de Boulogne: »Die Natur begann im Bois, aus dem die Idee, er sei der elysische Garten der Frau, sich verflüchtigt hatte, ihr Reich wieder aufzurichten; der wirkliche Himmel über der künstlichen Mühle war von Wolken verhangen; der Wind durchfurchte den Grand Lac mit kleinen Wellen wie jeden anderen See; mächtige Vögel durchzogen den Bois, als sei er eben ein Wald, und fielen mit schrillen Schreien auf großen Eichen ein, die unter druidischen Kronen und in dodonäischer Majestät die unwirtliche Öde des entzauberten Haines laut zu verkünden schienen und mich verstehen lehrten, welcher Widersinn darin liegt, wenn man die Bilder der Erinnerung in der Wirklichkeit sucht, wo immer der Reiz ihnen fehlen muß, der im Gedächtnis wohnt und mit den Sinnen nicht wahrgenommen werden kann. Die Wirklichkeit, die ich einst gekannt hatte, gab es nicht mehr. Es genügte, daß Madame Swann nicht mehr als immer die gleiche im gleichen Augenblick unter ihren Bäumen erschien, und schon war die Avenue eine andere geworden. Die Stätten, die wir gekannt haben, sind nicht nur der Welt des Raums zugehörig, in der wir sie uns denken, weil es bequemer für uns ist. Sie waren nur ein schmaler Ausschnitt aus den einzelnen Eindrücken, die unser Leben von damals bildeten; die Erinnerung an ein bestimmtes Bild ist nur wehmutsvolles Gedenken an einen bestimmten Augenblick; und die Häuser, Straßen, Avenuen sind flüchtig, ach! wie die Jahre.« Mit solch starkem Szenario endet der erste Teil: in einem teils melancholischen, aber auch unerbittlichen Bild, das die Vergänglichkeit von Schönheit festhält. Und damit knüpft diese Passage bereits an den letzten Band der »Recherche« an, nämlich »Die wiedergefundene Zeit«. Dort freilich erleben wir einen ganz anderen Verfall: nämlich den der Gesellschaft und der Menschen. Zugleich enthält diese Natur-Szene die Frage danach, wie wir wahrnehmen, was wir wahrnehmen und wie wir die Ausschnitte unserer Wahrnehmung gewichten – auch dies wird für den letzten Teil wesentlich. Und ebenso bedeutsam bleibt die Frage, wie wir das, was wir wahrgenommen haben, festhalten und auf welche Weise wir diese Momente bewahren und aufheben können, so dass das Vergehen am Ende eben doch nicht vergeht. Was einst in junger Mädchen- oder Männerblüte stand, welkte. Aufhebung meint in diesem Falle jenen dialektisch-dreifaltigen Sinn, nämlich auch die Negation und dass etwas verschwindet – außer vielleicht in der Erinnerung und dann in der Literatur aufgehoben. Diejenigen Frauen, für deren Art und Wesen sich der Erzähler einst interessierte: sie sind gealtert, Akazien und Arkadien, das einst die Jugendzeit war, wandeln sich: »Ach! In der Avenue des Acacias – in dem Myrtenhain – traf ich noch manche von ihnen an, sie waren gealtert und nur noch schreckliche Schatten dessen, was sie einstmals waren, sie irrten umher und schienen wie verzweifelt in diesen vergilischen Bosketts nach irgend etwas zu suchen. Lange schon waren sie wieder fort, als ich die verlassenen Wege noch immer vergeblich befragte. Die Sonne hatte sich versteckt.« Bestürzende Szenen und eine Beobachtung, die auf die Natur und das Wahrnehmen selbst gerichtet ist, als Ort, das Vergehen zu bestimmten. Frei nach Freud kann man hier von einer gleichsam psychoanalytischen Technik sprechen: Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten Was bleibt, sind Erinnerungen. Dennoch: dieses Vergehen lässt sich in Sprache beschreiben. Darin liegt die große Möglichkeit der Kunst. Und die Möglichkeit der Kunst liegt ebenfalls darin, jene Melancholie und Trauer um solchen Verlust ästhetisch zu bewältigen und auch diesem Vergehen Schönheit abzugewinnen. In diesem Sinne ist Prousts großer Roman nicht nur eine Suche und eine Frage nach Gedächtnis und Erinnerung, sondern zugleich in vielen Passagen – dies zeigt sich besonders in »Die wiedergefundene Zeit« und den dort auf ästhetische Fragen reflektierenden zahlreichen Passagen – eine Kunstmetaphysik und zugleich auch eine Ästhetik, die sich, ganz wie es die literarische Frühromantiker in Jena um 1800 andachten, performativ, im Akt des Darstellens und Beschreibens als Ästhetik selbst vollzieht: nämlich Dichtung, die zugleich ihre eigenen Bedingungen mitdenkt. Dabei reisen wir Leser auf eine vielfältige Weise in die Welt der Kunst und damit verbunden: der verschiedenen Arten von Wahrnehmung – was bei Proust phasenweise zu synästhetischen Szenen und in die verschiedenen Kunstgattungen führt. Die drei berühmtesten Künstler des Buches sind der Maler Elstir, der Schriftsteller Bergotte und der Komponist Vinteuil, dessen Sonate für Swann, einen der Protagonisten dieses Romans, im Reich seiner seltsamen Liebe zu einer Kokotte eine wichtige Rolle spielt. Was kann man zum Lesen von Proust raten? Sich Zeit zu nehmen und sich auf jenen mäandernden, fließenden Text einzulassen, sich darin zu versenken und von allem außen abzusehen, um in den Rhythmus der Sprache zu gelangen. Nichts anderes zu tun, als jene sieben Bände zu lesen. Am Stück, Tag für Tag, es muss ja nicht im Bett im korkverschälten Zimmer mir Räucherschalen sein. Auch deshalb sollte der Leser derart verfahren, weil diese Teile, von nichts unterbrochen, zusammengehören: ein Fluss der Zeit, eine Einheit inmitten der Vielheit der Welt, der Vielzahl der Personen und Szenen. Um diese Einheit in Vielzahl zu erfahren, bedarf es einer seltenen und wichtigen Ressource: der Aufmerksamkeit. Dass die Aufmerksamkeit das natürliche Gebet der Seele sei, diesen Satz schrieben Celan und Benjamin dem französischen Philosophen Nicolas Malebranche zu. Er schrieb ihn zwar nicht, aber aufs Lesen von Proust passt dieser Satz dennoch: dieses Lesen in einem Zuge gleicht einer Versenkung nicht in einen Text, sondern in eine Sache. Proust selbst hatte ursprünglich vor, diese sieben Teile in einem einzigen Band herauszubringen. Ohne Zwischentitel und ohne Überschriften. Dies war buchtechnisch in der Verarbeitung jedoch nicht möglich. Mag es anfangs, beim ersten Lesen noch schwerfallen und mögen die Gedanken abgleiten und es schweift der Leser in die richtige Welt zurück und aus der Literatur wieder heraus, so wird sich doch, wie bei Meditationsübungen, mit der Zeit und je mehr man in den Fluss dieses Buches gerät, ein Rausch einstellen, ein Sog: dass dich der Text mit einem Male aufnimmt und du liest und liest und merkst dabei nicht einmal mehr, wie die Zeit vergeht und schon gar nicht erinnerst du, werter Leser, dich noch daran, Leser zu sein. Einen Schlüssel zu Proust Werk freilich gibt es nicht. Vielleicht nur das, wofür seinerzeit einmal der Ausdruck »Muße« stand. Diese Schweifende, sich in immer neuen Details Verlierende des Erzählers korrespondierte im Übrigen mit Prousts die Lektoren zur Verzweiflung treibenden Arbeitsweise, ins Manuskript immer noch neue und weitere Aspekte und Details einzufügen. Das eigene Sterben etwa in seinem Bettlager im korkverschälten Zimmer, protokollierte Proust im November 1922, um es der Beschreibung vom Tod des Schriftstellers Bergotte beizufügen. Dem Tod noch in der Dichtung ein Schippchen zu schlagen und ihn aufzuheben. In diesem Schreiben erfüllte sich ein ganzes, aber kurzes Leben. Am 10 Juli 1871 wurde Marcel Proust im feinen, noch ländlich geprägten Pariser Stadtteil Auteuil geboren – zum Ende des Deutsch-Französischen Krieges und in den Nachwehen der Pariser Kommune. Eine Zeit des Umbruchs.
[Die deutschen Zitate
aus der »Recherche« folgen der Übersetzung von Eva Rechel-Merten, in der
Überarbeitung von Luzius Keller, erschienen bei Suhrkamp.] |
Marcel Proust |
|
|
|
||
|
|
||
