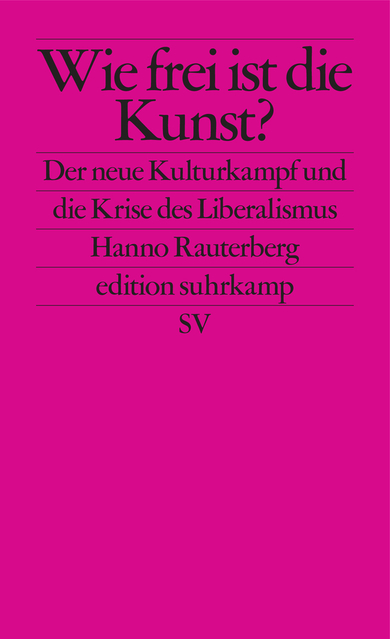|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
|||
|
|
»Ein
Caravaggio hätte heute keine Chance mehr« |
||
|
Kunst, die als Verunglimpfung, Herabsetzung oder Diskriminierung einer Person oder Personengruppe oder gesellschaftlichen Gruppierung aufgrund von Hautfarbe, Glauben, Geschlecht, körperlicher Verfassung, Alter oder nationaler Herkunft verstanden werden könnte sollte grundsätzlich von staatlichen Fördermitteln ausgeschlossen werden. Diese Forderung könnte durchaus als Imperativ im Rahmen eines zeitgenössischen Diskurses um einen sich neu formierenden Kunst- und Kulturbegriff stehen. Formuliert wurde er aber nicht von einem AStA, einer Gleichstellungsbeauftragten oder vermeintlich progressiven Kunstkritikern sondern bereits im Jahr 1989 vom 2008 verstorbenen republikanischen US-Senator Jesse Helms im Rahmen dessen, was man post festum "Culture wars" nannte. Helms wollte unter anderem diese Richtlinie als Zusatz zur amerikanischen Verfassung implementieren. Die Pointe: Er war ultra-konservativ, homophob und trat vehement gegen die Gleichberechtigung von Weißen und Schwarzen ein. Sein Vorstoß galt den damals "unzüchtigen" und "blasphemischen" Kunstprodukten beispielsweise eines Fotografen wie Robert Mapplethorpe, der Sängerin Madonna oder Martin Scorseses "Die letzte Versuchung Christi". Helms' Zitat ist aus Wie frei ist die Kunst?, dem neuesten Buch des ZEIT-Feuilletonredakteurs Hanno Rauterberg. Es trägt den Untertitel Der neue Kulturkampf und die Krise des Liberalismus. Aus vier Sichtweisen – Produktion (Künstler), Distribution (Museen), Rezeption und Integration – untersucht Rauterberg das gewandelte Verständnis von Kunst von der Moderne über die Postmoderne hin zur Gegenwart, die im Buch Digitalmoderne genannt wird. In der Einleitung benennt Rauterberg an einigen Beispielen der letzten Zeit die sich strikt an "Werte" orientierenden Ansprüche an Kunst. Da werden Personen aus Filmen herausgeschnitten, die wegen sexueller Übergriffe angezeigt wurden. Da wird ein Gedicht an einer Häuserfassade übermalt, weil es frauenverachtend und sexistisch sein soll. Als diskriminierend empfundene Wörter sollen aus Büchern getilgt werden. Werkschauen werden aufgrund von Sexismus-Vorwürfen an den Künstler abgesagt oder als anstößig empfundene Kunstwerke aus Ausstellungen entfernt. Karikaturen bleiben ungezeigt, weil sie religiöse Gefühle verletzen könnten. War die Moderne die Agentin der Öffnung, die mit avantgardistischem Impetus das Bewährte überschreiten und sittliche Grenzen weiten wollte, so wird aus der Kunst in der Digitalmoderne die Emissärin einer abgrenzenden Vergewisserung, für viele Einzelne und mehr noch für Kollektive. Die Bewertung von Kunstwerken geschieht daraufhin, ob Empfindungen bei Rezipienten verletzt werden. Rauterberg nennt dies das Unwohlsein des Einzelnen. Das Unwohlsein gebiert "Opfer", die, wenn ihnen selber nicht "unwohl" ist, paternalistisch beschützt werden müssen. Das Widersprüchliche, Sperrige, zur Not auch Abseitige wird gar nicht erst diskutiert, sondern sofort abgelehnt. Das Unwohlsein, so Rauterberg, mag einen berechtigten Grund haben, denn es kann sich um Fälle politischer oder ökonomischer Beteiligung handeln. Doch um diese Benachteiligung zu bekämpfen, favorisiert die politische Korrektheit eben keine offensiv politische oder ökonomische Gegenwehr, vielmehr setzt sie vornehmlich auf eine Veränderung in ihrer Wortwahl und Verhaltensweise… Die Folge sei paradoxerweise eine verstärkte Emotionalisierung, obwohl es ja gerade die Affekte sind, die normativ geregelt werden sollten. Letzteres ist eine nicht ganz schlüssig belegte Behauptung. Geht es nicht gerade darum, Affekte zu erzeugen um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Rauterberg spricht selber von Affektgemeinschaften, in der die Rücksicht auf Partikularinteresssen über das allgemein Verbindende und Ästhetische stehen. Ihre Protagonisten sind laut und gut vernetzt. Sie benutzen die digitalen Medien als Verstärker. Es genügt, dass ein Gedicht als sexistisch, ein Künstler als übergriffig, ein Kunstwerk als gewaltverherrlichend und/oder rassistisch, eine Formulierung als diskriminierend postuliert wird. Die Reaktionen der Kunstinstitutionen – der Museen und Galerien, in einem Fall auch eines Theaters – werden ausgiebig dokumentiert. Nahezu immer endet es mit dem Einlenken auf den Protest. Ausstellungen (und nicht nur diese) werden somit zu politischen Programmen umfunktioniert. Wichtig ist dabei einzig die Empfindsamkeit jedes Einzelnen, die den Diskurs und den "Wert" des Kunstwerkes bestimmt. Jede noch so kleine Minderheit kann damit die Verbreitung eines Kunstwerkes hemmen, insofern sie sich angegriffen, diskriminiert oder beleidigt fühlt. Weiterer Begründungen bedarf es nicht. Diskussion um ästhetische Kriterien unterbleiben. Rauterberg nennt dies an einer Stelle einen ästhetischen Klimawandel. Hier ist eine erste kritische Bemerkung angebracht. Zwar ist es lobenswert, dass sich der Autor bemüht, den Affekten nicht seinerseits nachzugeben und sehr wohl Argumente für diese Form der interventionalistischen Kunst"kritik" findet. Und auch sein Befund ist klar: diese Form des Umgangs mit Kunst konterkariert den Liberalismus, der gerade in der Moderne ihre größte Ausprägung gefunden hatte und sich auch in der Gesellschaft – gegen alle regressiven Widerstände – niederschlug. Dennoch will er nicht pauschalisierend von einem Angriff auf die Freiheit der Kunst sprechen, seien doch die Ausprägungen insgesamt bisher zu vernachlässigen. Die Argumentation des AStA in der Diskussion um die Entfernung des Gomringer-Gedichts von der Fassade des Gebäudes gilt hier als Indiz, dass die Initiatoren nicht die Kunstfreiheit per se angreifen, weil sie zugestehen, dass sich jeder das Gedicht in seine Wohnung hängen könne. Es gehe nur um die Entfernung des als frauenfeindlich empfundenen Textes aus der Öffentlichkeit. Ein Argument, dass in Bezug auf museale Kunstwerke und Performances allerdings nicht mehr gilt. Den anmaßenden Totalitarismus, der in solchen "Gnadenakten" liegt, erkennt er nicht. Erst im letzten Kapitel, als er von den vermeintlichen Rettern der Kunstfreiheit berichtet, die er vor allem auf der politischen rechten Seite verortet, kommt ihm das Wort von der "Illiberalität" in den Sinn. Hellsichtig erklärt er zwar, dass die rechten/identitären Bewegungen die Kritik an der moralisierenden Kunstbetrachtung als trojanisches Pferd für ihre eigenen, restaurativen Kunstauffassungen missbrauchen. Einen Mittelweg beschreibt er jedoch nicht. Somit gerät man schnell unter Restaurationsverdacht. Damit spielt er unfreiwillig-freiwillig das Spiel derer, die das, was er die Liberalität nennt, aushebeln. Dass die Illiberalität der rechten und linken nur zwei Seiten der gleichen Medaille sind, kommt nur sehr dezent vor: Es war die Kunst, die dem Individuum eine größtmögliche Freiheit zugestand, damit es sich selbst und womöglich eine höhere Wahrheit finde und auf diese Weise die Gesellschaft zu eigenen Freisinnigkeit anregen könne. Dieser Impuls droht – egal von welchem Lager – abgewürgt zu werden. Richtig heißt es: Nicht die Fixierung auf feste Identitäten war die Bestimmung dieser liberalen Kunst, vielmehr zog sie alle und alles hinein in ein Spiel befreiender, universell gemeinter Wandelbarkeit. Statt die Zumutungen des Liberalismus zu ertragen werden Positionen bezogen und das fundamentalistische Verlangen nur noch größer. So schwindet das Ungewisse der Kunst, ihre schöne, funkelnde Polyvalenz. Sie sei, so die Quintessenz, das wahre Opfer der Kulturkämpfe. Museen agieren aus Furcht vor Shitstorms. Der Besucher wird bevormundet, indem ihm nicht für adäquat gehaltene Kunst verborgen bleibt. Und wenn nicht das, werden "unpassende" Titel von Kunstwerken mit Sternchen abgeändert. Exponate werden nicht mehr im Kontext der Zeit gesehen, sondern mit heutigen Sichtweisen bewertet. Es findet eine Enthistorisierung der Exponate statt. Etwas, was verstärkt auch für die Literatur beobachtet werden kann. Keine Frage, Rauterberg beschreibt sehr stimmig das essentialistische Denken, welches den Einzelnen auf seine Merkmale reduziere und somit sofort Affekte produziert, wenn es "unpassende" Kunst und/oder Künstler gebe. Hier ist er von Peter Sloterdijks Diktum, die Massenkommunikation als das organisierte "permanente Plebiszit gemeinsamer Sorgen" sieht, nicht weit entfernt. Gesellschaft existiere, so Sloterdijk, nur noch als "massenmedial integrierte, zumeist polythematische Stress-Kommune". Wichtig ist nur noch, die Balance zwischen Ablenkung und Stress, zwischen "lockeren unterhaltungsgemeinschaftlichen" und "dichten kampfgemeinschaftlichen" Zuständen zu finden. Einiges spricht dafür, dass aus der Unterhaltungsgemeinschaft eine veritable Hyperventilationsgemeinschaft geworden ist. Wer die Erregungen über Kunstwerke und Künstler in den letzten Jahren verfolgt hat stellt, so Rauterberg, fest, dass Mitsprache- und Urteilskompetenz längst nach Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung gewichtet werden. Dabei erlischt allerdings jede Form von produktivem Diskurs, weil infolge einer Erosion gesellschaftlicher Verbindlichkeiten keine überindividuell gültigen Argumente mehr existieren. Stattdessen entsteht eine Heuristik des Verdachts. Der (selbstverschuldete) Verlust des freien Denkens und Argumentierens wird an etlichen (zumeist US-amerikanischen) Beispielen gut illustriert (deutsche Vorkommnisse, wie der "Fall" Dieter Wedel, fehlen – als ZEIT-Redakteur wäre es im letzten Fall wohl zu kritisch). Statt der erwähnten gesellschaftlichen Verbindlichkeiten gibt es ominöse, einseitig verfasste Verbote und Tabuisierungen, die einen Absolutheitsanspruch behaupten. Nicht nur die 70er Jahre Freizügigkeit ist passé. Auch die Trennung von Autor und Werk existiert längst nicht mehr. Warum dies so ist, bleibt hier ungewiss. Eine Mitschuld ist sicherlich dem Feuilletonismus zu geben, der diese Verknüpfung aus Gründen der griffigeren Schreibe wegen seit vielen Jahren praktiziert. Ein wenig arg schematisch erscheint Rauterbergs Rekurs auf das, was er Digitalmoderne nennt. Es handelt sich um einen Begriff, der die Bedeutung der digitalen Medien auf die gegenwärtige Kunstrezeption und –beurteilung verdeutlichen soll. Das Internet ist zwar nicht der "böse Bube", aber letztlich die Instanz, die die Idiosynkrasien und Forderungen transportiert, wenn nicht gar verursacht. Ein Beispiel sind für ihn die Mohammed-Karikaturen. Aber bereits zu "analogen" Zeiten gelang die angesprochene Mobilisierung des Unbehagens, wie man an den weltweiten Protesten über Salman Rushdies "Satanische Verse" 1988 sehen kann (die Lektüre dieses Buches zur Begründung der Kränkung schien entbehrlich; man kennt dies allerdings auch aus anderen Kulturkreisen). Und auch der Blick auf die Kulturkämpfe in den 1990er Jahren in den USA (der gestreift wird) hätte ihm sagen müssen, dass dies nur ein Teil der Wahrheit ist. Natürlich kann man heutzutage in kurzer Zeit Petitionen und Shitstorms zu Allem und gegen jeden binnen weniger Stunden mit ein paar Tausend Unterschriften initiieren. Damit ist allerdings nichts über die Repräsentation dieser Interventionen gesagt. Die viel beschworene "Demokratisierung", die durch das Internet auch in ästhetischen Fragen hergestellt werden soll, ist nämlich oft genug nichts anderes als ein Projekt von einer Minderheit in der Minderheit. Verlässliche Zahlen über die Nutzung beispielsweise von Twitter existieren nicht – es schwankt zwischen rund 2 Millionen "regelmässiger" Nutzer in Deutschland bis zu 12 Millionen -, aber die Zahl derer, die den Klicktivismus als aktivistisches Medium verwenden dürfte im Verhältnis zum Resonanzraum, der erzeugt werden soll, marginal sein. Sicherlich, in einem kleinen Topf kann Wasser kochen und dann ist es dort sehr heiß. Man darf das dann allerdings nicht mit den anderen Töpfen auf dem Herd und der Temperatur in der Küche verwechseln. Dass Initiativen in den sozialen Netzwerken eine breite gesellschaftliche Diskussion anstossen, ist eher selten. Unlängt war dies bei dem #Metoo-Hashtag zu beobachten. Allerdings müssen dann die "konventionellen" Medien dies aufnehmen und vertiefen. Die Vorgänge in der Literaturkritik und -rezeption klammert Rauterberg gänzlich aus. Wie es dort um das "Schnüffeln" in und um Texten steht, konnte man unlängst in diesem Beitrag nachlesen. Genreübergreifend ist zu bemerken, dass diese affektiv von Idiosynkrasien bestimmten Codizes keine temporäre Angelegenheit sein dürften. Zensurbleistift und Spitzer werden an den Universitäten weitergegeben. Einiges erinnert an die Unzeiten des sozialistischen Realismus. Abweichungen werden mit Verbannung sanktioniert, welche die Teilnahme an den Subventions- und sonstigen Fördertöpfen erschwert bzw. verunmöglicht. Spätere Kanonisierung fraglich bis ausgeschlossen. Und ein Künstler, der Stigmata aufweist, erzielt auch keine der inzwischen wahnsinnigen Preise für seine Werke auf dem Kunstmarkt mehr und wird für potentielle Sammler uninteressant. Ein Caravaggio hätte heute keine Chance mehr. Der leicht optimistische Ausblick in Bezug auf die Kunstszene kommt einem da fast ein wenig rührend vor. Rauterberg verzichtet auf Polemik und scharfe Formulierungen. Ebenso ist er sichtlich bemüht "Kampfbegriffe" ("PC", "Genderwahn") zu vermeiden. Nur einmal ist von politischer Korrektheit die Rede. Dabei ist seine Meinung durchaus eindeutig: Die Kunst verliert als Kampfmittel einer Selbstvergewisserungsindustrie ihre in der Moderne errungenen Freiheiten. Dennoch versucht er eine deeskalierende Sprache, um beide Seiten möglichst unvoreingenommen und vor allem ohne die (zu Recht) kritisierten Affekte darzustellen. Ziel ist es eine vermittelnde Position einnehmen. Sein Plädoyer für den "Liberalismus" in der Kunst bleibt dabei leider etwas konturlos, weil der Begriff am Ende nicht ausreichend definiert wird. So ist der Text mehr Aufsatz als Essay. Trotzdem ist Wie frei ist die Kunst? der gelungene Versuch einen Überblick über die aktuelle Verfasstheit vor allem in der Kunstszene zu verschaffen. Demzufolge eine fast unverzichtbare Lektüre. In einigen Jahren wird man dann sehen, ob die heutigen Zeiten als Beginn einer neuen Epoche oder nur als ein Strohfeuer gesehen werden. Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
Der Beitrag
kann hier diskutiert werden:
Begleitschreiben |
Hanno Rauterberg |
||
|
|
|||