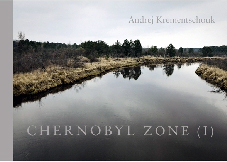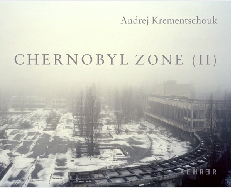|
Bücher & Themen

Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Glanz & Elend
empfiehlt:
50 Longseller mit
Qualitätsgarantie
Jazz aus der Tube u.a. Sounds
Bücher, CDs, DVDs & Links
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.»

|
Aktuelle sozialdokumentarische
Fotografie
 Der
in Heidelberg ansässige Kehrer-Verlag hat sich mit seinem ambitionierten
Kunstprogramm etabliert und
zu einem
Zentrum der modernen sozialdokumentarischen Fotografie entwickelt. Der
in Heidelberg ansässige Kehrer-Verlag hat sich mit seinem ambitionierten
Kunstprogramm etabliert und
zu einem
Zentrum der modernen sozialdokumentarischen Fotografie entwickelt.
Von Thomas
Hummitzsch
Zugegeben, die genannten
Verlage sind nicht die einzigen, in denen außergewöhnliche Kunst- und Fotobücher
erscheinen. Aber es sind zweifellos die Schwergewichte auf dem deutschen Markt.
Sich neben ihnen mit einem anspruchsvollen Programm zu etablieren, ist ein
Husarenstreich. Gelungen ist dieser dem noch jungen KEHRER-Verlag.
Der Anspruch, den sich die
Macher des Hauses gegeben haben, ist hoch. Zeitgenössische
Kunst und
Fotografie sowie die Kunst des 17. bis 19. Jahrhunderts stehen im Fokus des
Verlags, welches jeden seiner Titel nach eigener Auskunft in „enger
Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern, Autoren, Museen und kulturellen
Institutionen“ herstellt. Das Ergebnis sind außergewöhnliche Titel, die sowohl
inhaltlich als auch durch eine besondere Erscheinungsweise auffallen.
Dem
Autoren ist der Verlag mit dem Titel
Georgischer Frühling erstmals aufgefallen. Dabei
handelte es sich um den beeindruckenden Begleitband einer Ausstellung der
Aufnahmen von zehn Fotografen der renommierten MAGNUM-Agentur, die im Frühjahr
2009 durch Georgien reisten und den Status Quo des Landes in Bildern
festhielten. Die sozialen Zustände, historischen Wunden, traditionellen
Zeremonien und ersten Spuren der Moderne in dem sich im Aufbruch befindenden
Georgien hält dieser Band bis heute auf eindrucksvolle Weise fest.
Dieser Bildband ist
exemplarisch für Herangehensweise und Programm des Verlags. Sie alle sind von
Neugier und gesellschaftskritischen Interesse an den Realitäten der Gegenwart
geprägt, ohne dabei die Geschichte aus dem Blick zu verlieren. Zugleich stellen
sie Liebhaberstücke der sozialen Fotografie dar, verbinden den Ansatz der
sozialdokumentarischen Fotografie mit dem Anspruch cineastischer Erzählung.
Ungewöhnliche Themen und Perspektiven werden darin aufgegriffen und visuell
untersucht. Dabei werden Lücken geschlossen, von deren Existenz der Betrachter
noch gar nichts wusste. Einige ausgewählte Titel der jüngsten Programme sollen
dieses kühne Lob belegen.
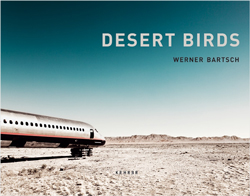 Der
Bildband Desert Birds mit Aufnahmen des deutschen Fotografen Werner
Bartsch, präsentiert Wracks. Schrittflugzeuge, rostige Treppenwagen und sinnlose
Anzeigentafeln. Bartsch hat im Südwesten der USA, in den Weiten der Steppen und
Wüsten von Arizona, Texas und New Mexico, die riesigen Flugzeuglagerplätze
aufgesucht und die skurrilen Schrottlandschaften festgehalten. Es sind Überreste
gigantischer Flugzeugflotten, die dort aufgereiht stehen, der Witterung und den
Plünderern ausgeliefert. Bartsch hat in dieser Kulisse Perspektiven gefunden und
Aufnahmetechniken angewandt, die die Schrottmaschinen zum Teil der Inszenierung
einer düsteren Zukunftsvision machen. Wolfgang Bartschs Perspektiven inszenieren
die metallenen Überreste zu Mahnmalen der Moderne. Die nicht selten langen
Belichtungszeiten legen über die Bilder einen metallenen Film, der den
Betrachter das Gefühl haben lässt, durch eine dystopische Landschaft zu wandern.
Mit seinen Fotografien macht ruft uns Werner Bartsch den Weg ins Bewusstsein,
den der Homo Sapiens in den zurückliegenden Dekaden eingeschlagen hat. Er
erzählt die Geschichte der selbstverschuldeten Tragödie der
ressourcenvernichtenden Globalisierung. Denn diese Flieger sind die Überreste
der menschlichen Sehnsucht, jederzeit überall unter den immer gleichen
Bedingungen leben und die eigene Welt in die Fremde und das Fremde in die eigene
Welt transportieren zu können. Der
Bildband Desert Birds mit Aufnahmen des deutschen Fotografen Werner
Bartsch, präsentiert Wracks. Schrittflugzeuge, rostige Treppenwagen und sinnlose
Anzeigentafeln. Bartsch hat im Südwesten der USA, in den Weiten der Steppen und
Wüsten von Arizona, Texas und New Mexico, die riesigen Flugzeuglagerplätze
aufgesucht und die skurrilen Schrottlandschaften festgehalten. Es sind Überreste
gigantischer Flugzeugflotten, die dort aufgereiht stehen, der Witterung und den
Plünderern ausgeliefert. Bartsch hat in dieser Kulisse Perspektiven gefunden und
Aufnahmetechniken angewandt, die die Schrottmaschinen zum Teil der Inszenierung
einer düsteren Zukunftsvision machen. Wolfgang Bartschs Perspektiven inszenieren
die metallenen Überreste zu Mahnmalen der Moderne. Die nicht selten langen
Belichtungszeiten legen über die Bilder einen metallenen Film, der den
Betrachter das Gefühl haben lässt, durch eine dystopische Landschaft zu wandern.
Mit seinen Fotografien macht ruft uns Werner Bartsch den Weg ins Bewusstsein,
den der Homo Sapiens in den zurückliegenden Dekaden eingeschlagen hat. Er
erzählt die Geschichte der selbstverschuldeten Tragödie der
ressourcenvernichtenden Globalisierung. Denn diese Flieger sind die Überreste
der menschlichen Sehnsucht, jederzeit überall unter den immer gleichen
Bedingungen leben und die eigene Welt in die Fremde und das Fremde in die eigene
Welt transportieren zu können.
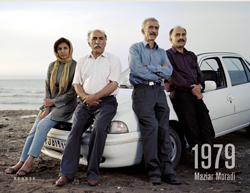 Dieser
menschlichen Sehnsucht nach der Fremde bedient sich auch der Verlag, etwa in
seinem Band 1979. Die dort versammelten Fotografien sind Wegmarken auf
der Suche nach einem gewissen Onkel Hamid, einem Verwandten des
deutsch-iranischen Fotografen Maziar Moradi. Wer dieser Onkel ist, bleibt selbst
nach der intensiven Betrachtung der versammelten 37 Farbfotografien verborgen.
Die einzelnen Aufnahmen stehen in keinem sich erschließenden Sinnzusammenhang.
Ihre scheinbar willkürliche Anordnung hebt jeden Bezug, der möglicherweise
einmal zwischen den Bildern bestand, auf. So wird des Betrachters Phantasie
angeregt, der nun Referenzen sucht, wo vielleicht nie welche waren. Zeitliche
und räumliche Zusammenhänge werden selbst kreiert, um dem Ganzen ein Sinn zu
geben. Es ist ein geradezu filmischer Prozess, der hier beim Betrachter
provoziert wird. Die Ästhetik der zeitlosen Aufnahmen Moradis erinnert dabei
wohl nicht zufällig an die Bildsprache des aktuell sehr erfolgreichen,
iranischen Kinos. 1979 ist die anregende Spurensuche einer dramatischen
Familiengeschichte, die in der Vergangenheit verankert ist und zugleich
zahlreiche Anspielungen auf die iranische Gegenwart enthält. Dieser
menschlichen Sehnsucht nach der Fremde bedient sich auch der Verlag, etwa in
seinem Band 1979. Die dort versammelten Fotografien sind Wegmarken auf
der Suche nach einem gewissen Onkel Hamid, einem Verwandten des
deutsch-iranischen Fotografen Maziar Moradi. Wer dieser Onkel ist, bleibt selbst
nach der intensiven Betrachtung der versammelten 37 Farbfotografien verborgen.
Die einzelnen Aufnahmen stehen in keinem sich erschließenden Sinnzusammenhang.
Ihre scheinbar willkürliche Anordnung hebt jeden Bezug, der möglicherweise
einmal zwischen den Bildern bestand, auf. So wird des Betrachters Phantasie
angeregt, der nun Referenzen sucht, wo vielleicht nie welche waren. Zeitliche
und räumliche Zusammenhänge werden selbst kreiert, um dem Ganzen ein Sinn zu
geben. Es ist ein geradezu filmischer Prozess, der hier beim Betrachter
provoziert wird. Die Ästhetik der zeitlosen Aufnahmen Moradis erinnert dabei
wohl nicht zufällig an die Bildsprache des aktuell sehr erfolgreichen,
iranischen Kinos. 1979 ist die anregende Spurensuche einer dramatischen
Familiengeschichte, die in der Vergangenheit verankert ist und zugleich
zahlreiche Anspielungen auf die iranische Gegenwart enthält.
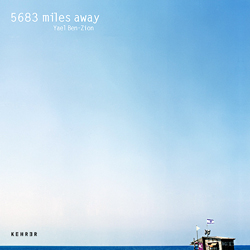 In
die Vergangenheit ist auch Yael Ben-Zion eingetaucht, als sie die 5683 Meilen
auf sich genommen hat, die sie von ihrem neuen Zuhause New York und ihrer alten
Heimat Tel Aviv trennen. Ihr dokumentarischer Bildband 5863 miles away
ist der Versuch, sich Israel und seiner besonderen Situation aus der Ferne zu
nähern. Dabei rückt sie Israel förmlich auf den Leib. Ihre Detailaufnahmen
erzählen von Ben-Zions Befremden gegenüber dem israelischen Alltag, der von dem
Zustand der Militarisierung und Abschottung geprägt ist. Ben-Zion will mit ihrer
Details einfangenden Fotografie keine moralische Diskussion über Schuld und
Unschuld oder Täter und Opfer führen. Sie will auch nicht nach der Berechtigung
der nahöstlichen Paranoia fragen. Sie will nur nüchtern aufzeigen, wie sehr
dieser Zustand den israelischen Alltag durchdrungen hat. Ihre Objekte sind die
Metaphern dieses absurden Daseins: die Katze vor der Eingangsschwelle zum
Luftschutzbunker, die nackte Barbie vor der französischen Ausgabe von
Schindlers Liste, die gefallene Krone. Als Yael Ben-Zion noch in Israel
lebte, wären ihr diese Dinge und deren Symbolhaftigkeit nicht aufgefallen. Erst
der Blick aus der Fremde hat dies möglich gemacht. Ihr Kaleidoskop der Eindrücke
ergibt am Ende das Bild eines Landes im Ausnahmezustand, den man erst von außen
gesehen als kafkaesk wahrnimmt, weil er von innen betrachtet Normalität ist. In
die Vergangenheit ist auch Yael Ben-Zion eingetaucht, als sie die 5683 Meilen
auf sich genommen hat, die sie von ihrem neuen Zuhause New York und ihrer alten
Heimat Tel Aviv trennen. Ihr dokumentarischer Bildband 5863 miles away
ist der Versuch, sich Israel und seiner besonderen Situation aus der Ferne zu
nähern. Dabei rückt sie Israel förmlich auf den Leib. Ihre Detailaufnahmen
erzählen von Ben-Zions Befremden gegenüber dem israelischen Alltag, der von dem
Zustand der Militarisierung und Abschottung geprägt ist. Ben-Zion will mit ihrer
Details einfangenden Fotografie keine moralische Diskussion über Schuld und
Unschuld oder Täter und Opfer führen. Sie will auch nicht nach der Berechtigung
der nahöstlichen Paranoia fragen. Sie will nur nüchtern aufzeigen, wie sehr
dieser Zustand den israelischen Alltag durchdrungen hat. Ihre Objekte sind die
Metaphern dieses absurden Daseins: die Katze vor der Eingangsschwelle zum
Luftschutzbunker, die nackte Barbie vor der französischen Ausgabe von
Schindlers Liste, die gefallene Krone. Als Yael Ben-Zion noch in Israel
lebte, wären ihr diese Dinge und deren Symbolhaftigkeit nicht aufgefallen. Erst
der Blick aus der Fremde hat dies möglich gemacht. Ihr Kaleidoskop der Eindrücke
ergibt am Ende das Bild eines Landes im Ausnahmezustand, den man erst von außen
gesehen als kafkaesk wahrnimmt, weil er von innen betrachtet Normalität ist.
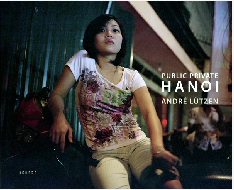 Normalität
– diese hat André Lützen in Vietnam gesucht, genauer gesagt in Hanoi. Die in dem
Band Public Private Hanoi versammelten Aufnahmen zeigen ungeschönt die
sozialen Gegebenheiten in der vietnamesischen Hauptstadt. Aufbruch und Verfall,
Tradition und Moderne, Lebenslust und Seelenleid, Reichtum und Armut,
verzaubernde Romantik und nackte Realität sind nur einige der Pole, zwischen
denen sich Lützens Fotografien bewegen. Sie zeigen nicht nur, dass die
schimmlige Patina in dem tropisch-feuchten Klima hartnäckig die Häuserwände im
Griff hat, sondern auch, wie die Spuren der tragischen Geschichte Vietnams die
Menschen und ihren Alltag prägen. Public Private Hanoi ist vor allem aber
auch eine Dokumentation des öffentlich zelebrierten Privatlebens. Wenn die
eigenen vier Wände zu klein oder muffig sind, wird das Wohnzimmer vor die
Eingangstür und der Küchentisch auf dem Bürgersteig gesetzt. André Lützens
Hanoi-Band ist eine facettenreiche Liebeserklärung an die nordvietnamesische
Stadt und ihre Bewohner, die voller Bewunderung für deren Lebensmut angesichts
der sie umgebenden Umstände sind. Normalität
– diese hat André Lützen in Vietnam gesucht, genauer gesagt in Hanoi. Die in dem
Band Public Private Hanoi versammelten Aufnahmen zeigen ungeschönt die
sozialen Gegebenheiten in der vietnamesischen Hauptstadt. Aufbruch und Verfall,
Tradition und Moderne, Lebenslust und Seelenleid, Reichtum und Armut,
verzaubernde Romantik und nackte Realität sind nur einige der Pole, zwischen
denen sich Lützens Fotografien bewegen. Sie zeigen nicht nur, dass die
schimmlige Patina in dem tropisch-feuchten Klima hartnäckig die Häuserwände im
Griff hat, sondern auch, wie die Spuren der tragischen Geschichte Vietnams die
Menschen und ihren Alltag prägen. Public Private Hanoi ist vor allem aber
auch eine Dokumentation des öffentlich zelebrierten Privatlebens. Wenn die
eigenen vier Wände zu klein oder muffig sind, wird das Wohnzimmer vor die
Eingangstür und der Küchentisch auf dem Bürgersteig gesetzt. André Lützens
Hanoi-Band ist eine facettenreiche Liebeserklärung an die nordvietnamesische
Stadt und ihre Bewohner, die voller Bewunderung für deren Lebensmut angesichts
der sie umgebenden Umstände sind.
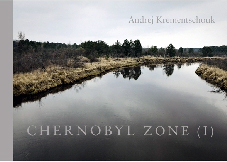 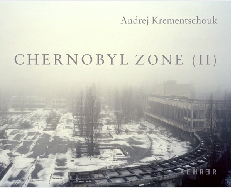
Wer den russischen Fotograf Andrej Krementschouk noch nicht kennt, wird ihn in
diesem Frühjahr kennenlernen. Mit Chernobyl Zone 1 und Chernobyl Zone
2 erscheinen zwei viel versprechende Titel. 25 Jahre nach der größten
nuklearen Katastrophe präsentieren sie seine schon oft gezeigten und immer
wieder beeindruckenden Bilder aus dem Sperrgebiet rund um den nur notdürftig
verschlossenen Atomreaktor. Es sind Fotografien aus einer surrealen Endzeitwelt,
märchenhaft und Angst einflößend. Seine Bilder wurden schon in den Hamburger
Deichtorhallen oder im Martin-Gropius-Bau ausgestellt, er ist also längst kein
unbekannter mehr. Das Konzept hinter seinen Aufnahmen ist das einer
Schocktherapie. Mit seinen Bildern erzählt Krementschouk die verheerende
Geschichte des Super-GAUs und führt mit der Präsentation der erschreckenden
Folgen eine düstere Zukunftsvision vor Augen. Mit seinem ersten Titel No
Direction Home, in dem er seine Suche nach emotionaler Verwurzelung und
kultureller Identität in Russland dokumentierte, gewann Krementschouk im
vergangenen Jahr den Siegertitel Silber beim Deutschen Fotobuchpreis.
Die hier exemplarisch
vorgestellten Fotobände stellen nur eine Auswahl des anspruchsvollen Programms
dieses bemerkenswerten Kunstbuchverlags dar. Mit einigem Recht kann sich der
Verlag Kehrer als deutsches Zentrum der modernen sozialdokumentarischen
Fotografie fühlen. Die Achtung der hier versammelten Fotografen vor der
Wirklichkeit und ihre aufgeschlossene Einstellung gegenüber dem Menschlichen
erinnern an den Anspruch der MAGNUM-Fotoagentur.
|
Werner Bartsch
Desert Birds
Mit einem Vorwort von Sophia Greiff. Kehrer-Verlag, Heidelberg 2010
112 S., 36,- EUR
ISBN: 3868281797.
Maziar Moradi
1979
Übersetzt von Alexandra Cox
Kehrer-Verlag, Heidelberg 2010
96 S., 36,- EUR
ISBN: 3868281185.
Yael Ben-Zion
5683 miles away
Mit einem
Vorwort von Joanna Lehan. Kehrer-Verlag, Heidelberg 2010
88 S., 36,- EUR
ISBN: 3868281217.
André Lützen
Public Private Hanoi
Mit einem
Vorwort von Nora Luttmer. Kehrer-Verlag, Heidelberg 2010
120 S., 39,80 EUR
ISBN: 3868281509
Andrej
Krementschouk
Chernobyl Zone I
Kehrer-Verlag, Heidelberg 2011
120 S., 80,- EUR
ISBN: 3868282009
Andrej
Krementschouk
Chernobyl Zone II
Mit Texten von Wolfgang Kil und Thomas Schirmböck
Kehrer-Verlag, Heidelberg 2011
120 S., 25,- EUR
ISBN: 3868282106
|
 Versandkostenfrei bestellen!
Versandkostenfrei bestellen!

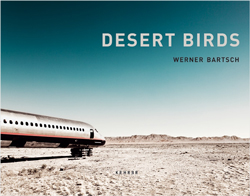 Der
Bildband Desert Birds mit Aufnahmen des deutschen Fotografen Werner
Bartsch, präsentiert Wracks. Schrittflugzeuge, rostige Treppenwagen und sinnlose
Anzeigentafeln. Bartsch hat im Südwesten der USA, in den Weiten der Steppen und
Wüsten von Arizona, Texas und New Mexico, die riesigen Flugzeuglagerplätze
aufgesucht und die skurrilen Schrottlandschaften festgehalten. Es sind Überreste
gigantischer Flugzeugflotten, die dort aufgereiht stehen, der Witterung und den
Plünderern ausgeliefert. Bartsch hat in dieser Kulisse Perspektiven gefunden und
Aufnahmetechniken angewandt, die die Schrottmaschinen zum Teil der Inszenierung
einer düsteren Zukunftsvision machen. Wolfgang Bartschs Perspektiven inszenieren
die metallenen Überreste zu Mahnmalen der Moderne. Die nicht selten langen
Belichtungszeiten legen über die Bilder einen metallenen Film, der den
Betrachter das Gefühl haben lässt, durch eine dystopische Landschaft zu wandern.
Mit seinen Fotografien macht ruft uns Werner Bartsch den Weg ins Bewusstsein,
den der Homo Sapiens in den zurückliegenden Dekaden eingeschlagen hat. Er
erzählt die Geschichte der selbstverschuldeten Tragödie der
ressourcenvernichtenden Globalisierung. Denn diese Flieger sind die Überreste
der menschlichen Sehnsucht, jederzeit überall unter den immer gleichen
Bedingungen leben und die eigene Welt in die Fremde und das Fremde in die eigene
Welt transportieren zu können.
Der
Bildband Desert Birds mit Aufnahmen des deutschen Fotografen Werner
Bartsch, präsentiert Wracks. Schrittflugzeuge, rostige Treppenwagen und sinnlose
Anzeigentafeln. Bartsch hat im Südwesten der USA, in den Weiten der Steppen und
Wüsten von Arizona, Texas und New Mexico, die riesigen Flugzeuglagerplätze
aufgesucht und die skurrilen Schrottlandschaften festgehalten. Es sind Überreste
gigantischer Flugzeugflotten, die dort aufgereiht stehen, der Witterung und den
Plünderern ausgeliefert. Bartsch hat in dieser Kulisse Perspektiven gefunden und
Aufnahmetechniken angewandt, die die Schrottmaschinen zum Teil der Inszenierung
einer düsteren Zukunftsvision machen. Wolfgang Bartschs Perspektiven inszenieren
die metallenen Überreste zu Mahnmalen der Moderne. Die nicht selten langen
Belichtungszeiten legen über die Bilder einen metallenen Film, der den
Betrachter das Gefühl haben lässt, durch eine dystopische Landschaft zu wandern.
Mit seinen Fotografien macht ruft uns Werner Bartsch den Weg ins Bewusstsein,
den der Homo Sapiens in den zurückliegenden Dekaden eingeschlagen hat. Er
erzählt die Geschichte der selbstverschuldeten Tragödie der
ressourcenvernichtenden Globalisierung. Denn diese Flieger sind die Überreste
der menschlichen Sehnsucht, jederzeit überall unter den immer gleichen
Bedingungen leben und die eigene Welt in die Fremde und das Fremde in die eigene
Welt transportieren zu können.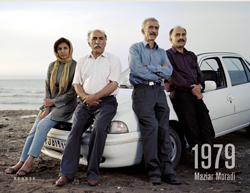 Dieser
menschlichen Sehnsucht nach der Fremde bedient sich auch der Verlag, etwa in
seinem Band 1979. Die dort versammelten Fotografien sind Wegmarken auf
der Suche nach einem gewissen Onkel Hamid, einem Verwandten des
deutsch-iranischen Fotografen Maziar Moradi. Wer dieser Onkel ist, bleibt selbst
nach der intensiven Betrachtung der versammelten 37 Farbfotografien verborgen.
Die einzelnen Aufnahmen stehen in keinem sich erschließenden Sinnzusammenhang.
Ihre scheinbar willkürliche Anordnung hebt jeden Bezug, der möglicherweise
einmal zwischen den Bildern bestand, auf. So wird des Betrachters Phantasie
angeregt, der nun Referenzen sucht, wo vielleicht nie welche waren. Zeitliche
und räumliche Zusammenhänge werden selbst kreiert, um dem Ganzen ein Sinn zu
geben. Es ist ein geradezu filmischer Prozess, der hier beim Betrachter
provoziert wird. Die Ästhetik der zeitlosen Aufnahmen Moradis erinnert dabei
wohl nicht zufällig an die Bildsprache des aktuell sehr erfolgreichen,
iranischen Kinos. 1979 ist die anregende Spurensuche einer dramatischen
Familiengeschichte, die in der Vergangenheit verankert ist und zugleich
zahlreiche Anspielungen auf die iranische Gegenwart enthält.
Dieser
menschlichen Sehnsucht nach der Fremde bedient sich auch der Verlag, etwa in
seinem Band 1979. Die dort versammelten Fotografien sind Wegmarken auf
der Suche nach einem gewissen Onkel Hamid, einem Verwandten des
deutsch-iranischen Fotografen Maziar Moradi. Wer dieser Onkel ist, bleibt selbst
nach der intensiven Betrachtung der versammelten 37 Farbfotografien verborgen.
Die einzelnen Aufnahmen stehen in keinem sich erschließenden Sinnzusammenhang.
Ihre scheinbar willkürliche Anordnung hebt jeden Bezug, der möglicherweise
einmal zwischen den Bildern bestand, auf. So wird des Betrachters Phantasie
angeregt, der nun Referenzen sucht, wo vielleicht nie welche waren. Zeitliche
und räumliche Zusammenhänge werden selbst kreiert, um dem Ganzen ein Sinn zu
geben. Es ist ein geradezu filmischer Prozess, der hier beim Betrachter
provoziert wird. Die Ästhetik der zeitlosen Aufnahmen Moradis erinnert dabei
wohl nicht zufällig an die Bildsprache des aktuell sehr erfolgreichen,
iranischen Kinos. 1979 ist die anregende Spurensuche einer dramatischen
Familiengeschichte, die in der Vergangenheit verankert ist und zugleich
zahlreiche Anspielungen auf die iranische Gegenwart enthält.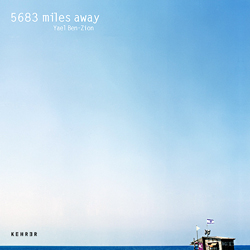 In
die Vergangenheit ist auch Yael Ben-Zion eingetaucht, als sie die 5683 Meilen
auf sich genommen hat, die sie von ihrem neuen Zuhause New York und ihrer alten
Heimat Tel Aviv trennen. Ihr dokumentarischer Bildband 5863 miles away
ist der Versuch, sich Israel und seiner besonderen Situation aus der Ferne zu
nähern. Dabei rückt sie Israel förmlich auf den Leib. Ihre Detailaufnahmen
erzählen von Ben-Zions Befremden gegenüber dem israelischen Alltag, der von dem
Zustand der Militarisierung und Abschottung geprägt ist. Ben-Zion will mit ihrer
Details einfangenden Fotografie keine moralische Diskussion über Schuld und
Unschuld oder Täter und Opfer führen. Sie will auch nicht nach der Berechtigung
der nahöstlichen Paranoia fragen. Sie will nur nüchtern aufzeigen, wie sehr
dieser Zustand den israelischen Alltag durchdrungen hat. Ihre Objekte sind die
Metaphern dieses absurden Daseins: die Katze vor der Eingangsschwelle zum
Luftschutzbunker, die nackte Barbie vor der französischen Ausgabe von
Schindlers Liste, die gefallene Krone. Als Yael Ben-Zion noch in Israel
lebte, wären ihr diese Dinge und deren Symbolhaftigkeit nicht aufgefallen. Erst
der Blick aus der Fremde hat dies möglich gemacht. Ihr Kaleidoskop der Eindrücke
ergibt am Ende das Bild eines Landes im Ausnahmezustand, den man erst von außen
gesehen als kafkaesk wahrnimmt, weil er von innen betrachtet Normalität ist.
In
die Vergangenheit ist auch Yael Ben-Zion eingetaucht, als sie die 5683 Meilen
auf sich genommen hat, die sie von ihrem neuen Zuhause New York und ihrer alten
Heimat Tel Aviv trennen. Ihr dokumentarischer Bildband 5863 miles away
ist der Versuch, sich Israel und seiner besonderen Situation aus der Ferne zu
nähern. Dabei rückt sie Israel förmlich auf den Leib. Ihre Detailaufnahmen
erzählen von Ben-Zions Befremden gegenüber dem israelischen Alltag, der von dem
Zustand der Militarisierung und Abschottung geprägt ist. Ben-Zion will mit ihrer
Details einfangenden Fotografie keine moralische Diskussion über Schuld und
Unschuld oder Täter und Opfer führen. Sie will auch nicht nach der Berechtigung
der nahöstlichen Paranoia fragen. Sie will nur nüchtern aufzeigen, wie sehr
dieser Zustand den israelischen Alltag durchdrungen hat. Ihre Objekte sind die
Metaphern dieses absurden Daseins: die Katze vor der Eingangsschwelle zum
Luftschutzbunker, die nackte Barbie vor der französischen Ausgabe von
Schindlers Liste, die gefallene Krone. Als Yael Ben-Zion noch in Israel
lebte, wären ihr diese Dinge und deren Symbolhaftigkeit nicht aufgefallen. Erst
der Blick aus der Fremde hat dies möglich gemacht. Ihr Kaleidoskop der Eindrücke
ergibt am Ende das Bild eines Landes im Ausnahmezustand, den man erst von außen
gesehen als kafkaesk wahrnimmt, weil er von innen betrachtet Normalität ist.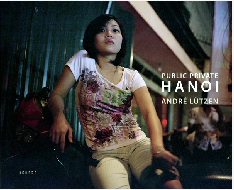 Normalität
– diese hat André Lützen in Vietnam gesucht, genauer gesagt in Hanoi. Die in dem
Band Public Private Hanoi versammelten Aufnahmen zeigen ungeschönt die
sozialen Gegebenheiten in der vietnamesischen Hauptstadt. Aufbruch und Verfall,
Tradition und Moderne, Lebenslust und Seelenleid, Reichtum und Armut,
verzaubernde Romantik und nackte Realität sind nur einige der Pole, zwischen
denen sich Lützens Fotografien bewegen. Sie zeigen nicht nur, dass die
schimmlige Patina in dem tropisch-feuchten Klima hartnäckig die Häuserwände im
Griff hat, sondern auch, wie die Spuren der tragischen Geschichte Vietnams die
Menschen und ihren Alltag prägen. Public Private Hanoi ist vor allem aber
auch eine Dokumentation des öffentlich zelebrierten Privatlebens. Wenn die
eigenen vier Wände zu klein oder muffig sind, wird das Wohnzimmer vor die
Eingangstür und der Küchentisch auf dem Bürgersteig gesetzt. André Lützens
Hanoi-Band ist eine facettenreiche Liebeserklärung an die nordvietnamesische
Stadt und ihre Bewohner, die voller Bewunderung für deren Lebensmut angesichts
der sie umgebenden Umstände sind.
Normalität
– diese hat André Lützen in Vietnam gesucht, genauer gesagt in Hanoi. Die in dem
Band Public Private Hanoi versammelten Aufnahmen zeigen ungeschönt die
sozialen Gegebenheiten in der vietnamesischen Hauptstadt. Aufbruch und Verfall,
Tradition und Moderne, Lebenslust und Seelenleid, Reichtum und Armut,
verzaubernde Romantik und nackte Realität sind nur einige der Pole, zwischen
denen sich Lützens Fotografien bewegen. Sie zeigen nicht nur, dass die
schimmlige Patina in dem tropisch-feuchten Klima hartnäckig die Häuserwände im
Griff hat, sondern auch, wie die Spuren der tragischen Geschichte Vietnams die
Menschen und ihren Alltag prägen. Public Private Hanoi ist vor allem aber
auch eine Dokumentation des öffentlich zelebrierten Privatlebens. Wenn die
eigenen vier Wände zu klein oder muffig sind, wird das Wohnzimmer vor die
Eingangstür und der Küchentisch auf dem Bürgersteig gesetzt. André Lützens
Hanoi-Band ist eine facettenreiche Liebeserklärung an die nordvietnamesische
Stadt und ihre Bewohner, die voller Bewunderung für deren Lebensmut angesichts
der sie umgebenden Umstände sind.