|
|
Anzeige Versandkostenfrei bestellen! Versandkostenfrei bestellen!
Die menschliche Komödie als work in progress Ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. |
||||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | |||||
|
Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |
»Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen
an.« Von Georg Patzer Wie verhält man sich in einer Diktatur? Dableiben, Widerstand leisten, sich zurückziehen oder fliehen? Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine erbitterte Kontroverse, als Walter von Molo Thomas Mann in einem Brief bat, zurückzukehren. Noch ehe Mann antworten konnte, griff Frank Thiess ihn und die anderen emigrierten Autoren an. Er hatte sich 1933 gedacht: »falls es mir gelänge, diese schauerliche Epoche (…) lebendig zu überstehen, würde ich dadurch derart viel für meine geistige und menschliche Entwicklung gewonnen haben, dass ich reicher an Wissen und Erleben daraus hervorginge, als wenn ich aus den Logen und Parterreplätzen des Auslands der deutschen Tragödie zuschaute (…) Ich glaube, es war schwerer, sich hier seine Persönlichkeit zu bewahren, als von drüben Botschaften an das deutsche Volk zu senden«. Der Nobelpreisträger Thomas Mann schlug am 12. Oktober 1945 zurück, als er schrieb, dass in seinen Augen »Bücher, die von 1933 bis 1945 in Deutschland überhaupt gedruckt werden konnten, weniger als wertlos« sind: »Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an.« Da hatte er schon vergessen, dass auch von ihm Bücher gedruckt, ausgeliefert und gekauft worden waren, z.B. die beiden ersten Bände seiner »Joseph«-Reihe. Die sehr lesenswerte, erweiterte und überarbeitete Neuauflage eines Lexikons, die diese Epoche in den Einträgen und dem knapp achtzig Seiten langen, konzisen Vorwort hell beleuchtet, ist jetzt erschienen: »Schriftsteller im Nationalsozialismus«. Das Nachschlagewerk listet viele Autoren auf: Nazis wie Hans Grimm (»Volk ohne Raum«), Ina Seidel oder Hanns Heinz Ewers (»Horst Wessel«-Roman), oder die konservativen Autoren Werner Bergengruen, Georg Britting oder Oskar Loerke, die sich zurückgezogen hatten in das, was Frank Thiess als »Innere Emigration« bezeichnete. Diese Gruppe von eigentlich mediokren Schriftstellern dominierte, wie das Vorwort nachweist, nach dem Krieg die Literaturszene, die Lesebücher und die Preisjurys, bis in die sechziger Jahre hinein. Bei manchen Namen wird man erstaunt sein, dass sie schon damals schrieben und durchaus mehr oder weniger vom Regime profitierten: Johannes Bobrowski, Lothar-Günther Buchheim oder Günter Eich, der sich 1940 in die von Goebbels initiierte Anti-England-Kampagne einspannen ließ. Bei anderen, dass sie sich für die Nazis stark machten, wenn auch manchmal nur kurz, wie Heimito von Doderer, der 1933 in Österreich in die NSDAP eintrat und die »jüdische Dominanz« seiner Heimat beklagte. Der bekannteste unter ihnen ist sicherlich Gottfried Benn, der als kommissarischer Leiter der Dichtersektion der Preußischen Akademie der Künste eine Loyalitätserklärung für Hitler entwarf, die alle Mitglieder unterschreiben mussten, und der 1933 in einer Rundfunkrede die bedingungslose Unterwerfung unter das NS-Regime verlangte, weil er das deutsche Volk als »letzte großartige Konzeption der weißen Rasse« sah. Nur wenig später allerdings ging er auf Distanz und verteidigte Picasso, Barlach und Nolde. Und ging, dann selbst angefeindet, in einer, wie er sagte, »aristokratischen Form der Emigrierung« zur Armee.
In manchmal sehr
ausführlichen Artikeln werden die oft krummen Wege der Autoren präzise und mit
vielen Belegen beschrieben. Hier kann man jetzt zuverlässig nachlesen, wie sich
Friedrich Sieburg, Heinrich Spoerl, Hermann Hesse, Günter Weisenborn, Max Frisch
verhalten haben, oder Karl Valentin, der sich nicht scheute, 1937 seinen
Konkurrenten Heinz Rühmann zu denunzieren. Es ist ein Standardwerk für die
deutsche Literaturgeschichte. Ein einziges Manko hat es: Es ist mit seinen knapp
700 Seiten zu dünn. Man wünscht sich sofort den zehnfachen Umfang, weil dieses
wunderbare |
Hans Sarkowicz,
Alf Mentzer |
|||
|
|
|||||
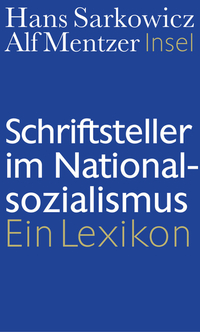 Die
Neuauflage des Standardwerks über »Schriftsteller im Nationalsozialismus« ist
erschienen
Die
Neuauflage des Standardwerks über »Schriftsteller im Nationalsozialismus« ist
erschienen