|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
|
Leben & Schreiben in Zeiten des
Krieges |
||
|
1934 publizierte der Verlag Gallimard mit "Die Komödie von Charleroi" eine Sammlung von sechs miteinander lose verbundenen Erzählungen des 1893 in Paris geborenen Schriftstellers Pierre Drieu la Rochelle. Und im Jahr 2016 erscheinen im Manesse-Verlage erstmalig diese Erzählungen in deutscher Sprache, übersetzt von Andrea Spingler und Eva Moldenhauer, mit einem Nachwort von Thomas Laux. Die gemeinsame Klammer der Erzählungen sind die Erlebnisse eines Ich-Erzählers im Ersten Weltkrieg. In der ersten, titelgebenden und längsten Geschichte begleitet dieser Erzähler als Sekretär Madame Pagan, eine wohlhabende Witwe der französischen Gesellschaft, bei ihrer Reise zu den Schlachtfeldern um Charleroi. Pagan besucht die Orte, an denen ihr Sohn gekämpft hatte und schließlich starb. Der Sekretär war in der gleichen Einheit wie Claude; irgendwann verlor man sich aber im Getümmel aus den Augen. Diese Besichtigung der alten Dame, die eigentliche Komödie, findet 1919 statt, aber die Erzählung selber, die wiederum nur eine Erinnerung ist, ist später niedergeschrieben. Und so überlagern sich drei Zeitebenen: Zum einen werden die Kriegs- und Schlachtenerlebnisse des Sekretärs erzählt. Zuweilen entspinnt sich hierüber 1919 ein direkter Dialog mit Madame Pagan und er muss sich sogar ihrer Vorwürfe erwidern, ihren Claude vernachlässigt zu haben. Und schließlich werden die Ereignisse aus der Sicht der politischen Lage im Europa der 1930er Jahre noch einmal reflektiert. Die Erzählung ist exemplarisch für das Weltbild jenes Sekretärs und ehemaligen Sergeants, der Züge des Autors Drieu selber trägt (das ist – wie immer – verführerisch für Exegeten) und dies nicht nur, weil er dem gleichen Jahrgang angehört. Madame Pagan geriert sich als Wohltäterin und übernimmt Patenschaften. Ihre Aura speist sich aus dem Wissen um ihre Kontakte zu Ministern der französischen Regierung. Die Auftritte sind Inszenierungen und die "Worte dieser Frau klangen stets gewollt". Jede Geste, jedes Wort wird vom Sekretär im Geheimen mit Abscheu und Verachtung seziert. Je mehr der ehemalige Verdun-Kämpfer aus seinen Kriegserlebnissen erzählt, desto mehr neigt der Leser dazu, dessen Ekel vor der oder Hass auf die französische Oberschicht zu verstehen. Entsprechend auch der Groll auf diesen "demokratischen Krieg", der die Klassengegensätze nicht aufhebt, sondern zementiert. In der Erzählung "Die Reise zu den Dardanellen" wird dies verdeutlicht: "Das alte Frankreich straffte sich, und eine alte Elite, großzügig unterstützt von einer auf dicke Gehälter und kleine Renten erpichten Demokratie, profitierte davon, um Geld zu verdienen und ein Reich zu konsolidieren." Geändert hatte sich am System auch nach den Millionen von Toten nichts; der Krieg wird nachträglich durch sein Ergebnis legitimiert. Auch wenn Claude, der Sohn aus reicher Familie, kein Offizier war, wird ihm jetzt ein Andenken zuteil, dass anderen verwehrt bleibt: Bürgermeisterempfang für die trauernde Mutter, Gottesdienst und am Ende werden sogar Soldatengräber exhumiert, nur damit Madame Pagan zweifelsfrei feststellen kann, dass ihr Sohn dort tatsächlich bestattet ist (was mit einem Indiz zu gelingen scheint). Zwischen Militärstratege und Angsthase Einige der Darstellungen des Schachtgewimmels können durchaus mit Jüngers "Stahlgewittern" mithalten, wobei Jünger eher als Berichterstatter fungiert als Drieu, der seinen Soldaten zwischen Held und Deserteur, Militärstratege und Angsthase pendeln lässt. So muss der einfache Sergeant den kommandierenden Offizieren die Lage erklären, Auswege formulieren und sogar Befehle ignorieren bzw. bessere Befehle ausgeben um nicht in irgendwelchen provisorisch gegrabenen Löchern elend zu krepieren. Einmal setzt er sich mitten im Feindbeschuss bei einem Vorgesetzten dahingehend durch, dass er einfach aufsteht und sich als Ziel anbietet. Soviel Heroismus macht Eindruck und kann nicht ignoriert werden. Drieus Erzähler ist vom Krieg angetan und abgestoßen zugleich; schwankt zwischen Größenwahn und Fatalismus. "Wenn man nicht mehr angreift, wird man angegriffen" – so die sich für ihn schnell zeigende, perverse Logik. Aber der Angriff selber droht irgendwann aufgerieben zu werden. Er hofft, dass die "dumme Hierarchie" der französischen Gesellschaft im Feld aufgehoben ist – und wird rasch eines Besseren belehrt. Aber nicht die von ihm respektvoll geschilderten, älteren und erfahrenen Stabsoffiziere – Oberste und Generäle – stehen an den Schnittstellen der Front, sondern die unerprobte, ängstlich-zaudernde Generation der Leutnant- und Hauptmann-Dienstgrade, die mit den sich laufend ändernden Kampfsituationen hoffnungslos überfordert sind. Die eigentlichen Kriegsherren bleiben jedoch vollkommen unsichtbar, residieren in ihren Palästen: Es ist ein "Krieg, der von allen geführt wurde, außer von denen, die ihn führten", heißt es einmal. Und zugleich ist dieser Krieg "kein Krieg für Krieger", weil seine Waffen aus Industrien kommen und anonym töten. Der Tod wird so fast unausweichlich, weil kaum jemand in der Lage ist, dieser Kriegsmaschinerie auszuweichen, geschweige denn auf Dauer standzuhalten. Auch in den anderen Erzählungen wird der Protagonist (dessen Kriegsetappen mit denen Drieus weitgehend übereinstimmen) auf diesen für ihn unüberbrückbaren Zwiespalt zurückkommen. Der Krieg, wie er in Verdun geführt wird, habe nichts "Edles an sich" stellt er in "Der Oberleutnant der Tirailleurs" fest. In dieser Geschichte begegnet der Erzähler 1917 in einer Bar in Marseille einem desillusionierten Oberleutnant, der sich nach Nordafrika absetzen möchte. Beide Figuren hassen die sich in diesem Krieg zeigende "moderne Welt" weil sie dem einzelnen Individuum am Ende nur noch den Status des Kanonenfutters übriglässt. Die Menschen "werfen einander Gewitter und Erdbeben an den Kopf, aber sie werden keine Götter. Und sie sind keine Menschen mehr". Selbst eine Beschwörung der Vergangenheit funktioniert nicht: "Der Krieg ist niemals rein gewesen." Als Dialog konzipiert, ist es eher ein Selbstmonolog. Auch "Der Deserteur" gleicht mehr einer essayhaften politischen Selbstverortung als einer Erzählung. Hier befindet sich der Erzähler auf einer Reise durch Südamerika und begegnet einem Franzosen, der im August 1914 auf nicht näher beschriebenen Wegen nach Südamerika "desertierte". Der Deserteur, der dem degenerierten Frankreich derart den Rücken kehrte, wird hier zu einem Idealisten, in dem er für die "Vereinigten Staaten von Europa" eintritt, um für alle Zeiten Kriege zu verhindern. Es wäre natürlich absurd, Drieu damit nachträglich zu einem Vorreiter einer europäischen Einigung zu machen. Er spielt hier mit den bereits durch den aufkommenden Faschismus denunzierten Begriffen wie Heimat und Nation. Der Nationalismus wird als "der schändlichste Aspekt des modernen Geistes" dargestellt, der mit "billiger Mystik" agiere. Und nun hätten sich die "beiden hässlichsten Finge auf der Welt, der Nationalismus und der Sozialismus" endlich "getroffen"; eine Anspielung auf den Nazismus in Deutschland. Der Erzähler ist verunsichert, sucht Schubladen für den Deserteur, erst ist er der "Ewige Jude" (Antwort: "Ich bin kein Jude, ich bin Burgunder") dann ein Liberaler, schließlich Sozialist, aber alles passt nicht. Als sich der Deserteur endlich auch noch als Bigamist outet endet das Gespräch abrupt. "Der Oberleutnant der Tirailleurs" und "Der Deserteur" sind antipodische Einakter. Einer stellt den Krieg in den Mittelpunkt politischen und gesellschaftlichen Denkens während der andere einem egoistisch motivierten Eskapismus das Wort redet, der notdürftig idealistisch verbrämt wird. Beides ist unbefriedigend; der Deserteur dürstet nahezu danach, sich endlich einmal wieder mit einem intelligenten Landsmann zu unterhalten, wird dann aber enttäuscht. Man spürt förmlich die Suchbewegungen des Autors, seine Versuche aus der Spirale der Verachtung von Aristokratie und Masse zu entfliehen. Aber es kommen immer wieder die Erinnerungen an den Krieg dazwischen. Er vermag sich nicht davon zu lösen. Das zerschmetterte Gesicht In "Der Hund der Heiligen Schrift" wird dies besonders deutlich, obwohl es hier keine direkten Schilderungen von Kampfhandlungen gibt. Der Erzähler, der einer "Angriffsdivision" angehört, die als "Holzfäller" in Ruhestellung auf ihren Einsatz in den Wäldern wartet, berichtet über einen Neuzugang in der Einheit, einen gewissen Grummer, der als "Maréchal des logis" vorgestellt wird. Eigentlich also nur ein Unteroffiziersrang entspricht Grummer durch Kleidung und Verhalten allen Klischees eines snobistischen "Adelsbürschchens", das nicht beabsichtigte, "sich die Hände schmutzig zu machen". Er wartete darauf, dass sein Versetzungsgesuch zur Luftwaffe angenommen wurde. Für den Dienst in dieser Einheit ist er physisch vollkommen ungeeignet. Bei einem sechsstündigen Fußmarsch bricht er fast zusammen und kann nur mit Not die Strecke bewältigen. Die Gerüchte, dass die Infanterie-Einheit in Verdun eingesetzt werden soll, verdichten sich und schließlich wird die Kompanie zusammengerufen. Vor allen Soldaten wird Grummer nun mitgeteilt, dass er zur Luftwaffe versetzt wurde und sofort die Einheit zu verlassen habe. Die Art und Weise wie Drieu dies als "moralische Ohrfeige" für den Snob erzählt, ist von wunderbarer Präzision. Aber es gibt noch eine zweite Ebene im Text: Die Erinnerung an dieses Ereignis ist verknüpft mit einem Besuch eines Kinofilms über Verdun – eine Einladung zu einer Gesellschaft, die der Erzähler eher aus Langeweile denn auch Neigung gefolgt war. Er schaut den Film über Verdun berührt und auch befremdet an als er plötzlich hinter sich eine ihm bekannte Stimme wahrnimmt. Es ist jener Grummer, der seiner Begleiterin seine Versionen über Verdun erzählt. Schließlich erkennt auch er den Erzähler und für einen peinlichen Moment, er sieht sich als Lügner ertappt, freilich ohne dass dies eine Konsequenz hätte. In "Die Reise zu den Dardanellen" wird von einem Regiment bei Marseille erzählt, dem neue Soldaten zugeführt werden, "als hätte es nicht bereits fünfhunderttausend Tote gegeben, die Gefangenen, Krüppel, Geschlechtskranken, Entmutigten nicht mitgerechnet". Zunächst treibt sich die Hauptfigur in diversen Freudenhäusern herum bis es dann abrupt auf das Schlachtfeld geht. Drieus Erzähler stilisiert sich trotz Durchfallattacken auch in diesem Text als umsichtiger Held. Aber schließlich wird ihm klar, dass gerade sein Eifer den Krieg entgegen seiner Intention verlängert. Paradoxerweise dient jedoch dieser Eifer auch dem Überleben. Die in der Komödie um Madame Pagan verpackten, teilweise expressionischen Schilderungen des Kampfes finden sich schließlich auch in "Das Ende des Krieges". Drieu beschreibt zunächst fast gelangweilt die Vorkommnisse in einer eigentlich schon als befriedet eingeschätzten Stellung wenige Tage vor einem erwarteten Frieden, die urplötzlich unter Beschuss genommen wird. Dabei wird man das zu Brei zerschmetterte Gesicht eines sich in seinen Schmerzen quälenden Offiziers sehr lange nicht mehr los. Nicht zum ersten Mal, aber mit einer besonderer Drastik zeigt Drieu das Motiv des geschundenen, tödlich verwundeten, um seinen Tod als Erlösung bettelnden Menschen. Drieu versteht es in den besten Augenblicken die menschlichen Abgründe wie unter einem Brennglas sichtbar werden zu lassen und die Zeit für Sekundenbruchteile anzuhalten. Dabei erscheint der Ich-Erzähler als zerrissene Persönlichkeit zwischen Nihilismus und Snobismus. Den Zynismus, die Ausflucht des Moralisten, vermeidet der Erzähler. Stattdessen verachtet er die Masse (damit auch das, was man Demokratie nennt) und deren Mittelmäßigkeit wie auch die politisch ausschlaggebende Oberschicht. "Aristokratischen Sozialismus" nennt er seine politische Gesinnung einmal, aber auch diese Einschätzung ist vage; die Erzählungen verstören gerade dahingehend, weil sie sich jeder Kategorisierung der Figuren entziehen. Drieu der Kollaborateur Spätestens wenn man sich mit dem Leben von Pierre Drieu la Rochelle beschäftigt wird die Lektüre seiner Erzählungen zu Politikum. So wundert es auch nicht, wenn Thomas Laux in seinem Nachwort (das auch in "Volltext" Heft 1/2016 abgedruckt wurde) den Fokus fast ausschließlich auf die zum Teil unappetitlichen politischen Eseleien Drieus liegt. Es beginnt mit einer anderthalbseitigen Schilderung eines, so Laux, "emblematischen" Fotos (dass dann leider nicht abgedruckt wurde – weder im Buch noch in "Volltext"), dass Drieu mit Gerhard Heller, der für die Nazis die "Literaturpolitik" im besetzten Frankreich koordinierte und anderen Nazi-Kollaborateuren auf einem Pariser Bahnsteig nach Rückkehr von einer von Goebbels 1941 inszenierten Kulturkonferenz aus Weimar zeigt. (Das Foto ist zwei Mal im Netz zu finden, so hier–Version 1 und hier–Version 2. Heller ist ganz links, daneben Pierre Drieu la Rochelle im langen Mantel mit Zigarette. Danach (v. l. n. r.): Georg Rabuse, Robert Brasillach [im weißen Mantel; der einzige der Kollaboration beschuldigte Schriftsteller, der 1945 trotz Interventionen u. a. von Camus hingerichtet werden wird], Abel Bonnard und André Fraigneau. Auf Version 2 ist auch noch Karl Heinz Bremer, Mitarbeiter von Heller, zu sehen.) Laux zitiert aus Drieus Frühwerk (u. a. "Blèche" von 1928 und "Das Irrlicht" [1931, verfilmt von Louis Malle 1963]), den Roman "Gilles" (1939) und findet Stellen in Tagebüchern über und vor allem von ihm, um festzustellen, dass hier jemand nahezu allen politischen Dummheiten irgendwann einmal aufgesessen war. Drieu war zunächst Sozialist, schließlich Franzosenhasser, mutierte zum Antisemiten (obwohl seine erste Frau Jüdin war) und sympathisierte ab 1935 offen mit dem Nationalsozialismus, den er sogar dafür kritisierte, in Frankreich zu spät einmarschiert zu sein. Den europäischen Faschismus sah er als Bollwerk sowohl gegen die Bourgeoisie als auch gegen den sowjetischen Kommunismus. Heller, der zwischen 1966 und 1972 fünf Romane Drieus übersetzen sollte, setzte diesen Ende 1940 als Chef der renommierten und von Gallimard herausgegebenen Literaturzeitschrift "Nouvelle Revue Française" (NRF) ein, was dem damals bereits schwermütigen Drieu aber immerhin ein Auskommen sicherte. Drieu war naturgemäß in der Szene bekannt. Die offensichtliche Kollaboration schreckte allerdings die meisten Autoren ab. Das einst so angesehene Magazin galt als Nazi-Blatt; die Auflage sank. Als sein Vorgänger (und Nachfolger) bei der NRF, Jean Paulhan, der in der französischen Résistance im Untergrund tätig war, 1941 in Gestapo-Haft kam, war es jedoch Drieus Intervention, die ihn vor Schlimmerem bewahrte. Laux erwähnt dies. Ob es Loyalität war oder ob Drieu der Hilfe Paulhans bedurfte, wie zuweilen gemutmaßt wird, bleibt ungewiss. Von Heller ist überliefert, dass Drieu ihn bat, Malraux, Aragon und Gaston Gallimard zu verschonen. Die Machtlosigkeit der Macht Gleichzeitig desillusionierte Drieu immer mehr was den Faschismus anging. In seinem 1943 erschienenen Roman "L'homme à cheval" ("Der Mann auf dem Pferd"), der 1981 unter dem Titel "Der bolivianische Traum" (Übersetzung: Friedrich Griese) erschien, kann man dies erspüren. Der Roman spielt in den 1860er Jahren in einem fiktiven Land, das Bolivien genannt wird (und Ortsnamen aus Bolivien enthält), aber der historische Rahmen ist frei erfunden bzw. passt nicht zur erzählten Zeit. Ich-Erzähler ist ein gewisser Felipe, ein ehemaliger Theologiestudent, der sich als Gitarrenspieler in die Umgebung des charismatischen Leutnants Jaime Torrijos begeben hat. Anfangs ist man eine wilde Truppe, treibt sich in Bars herum, veranstaltet "Gelage". Aber der junge, ehrgeizige Leutnant will Don Benito, den autokratischen Machthaber aus einer Familie "der Großen", beseitigen und sich selber an dessen Stelle setzen. Mit einer List Felipes gelingt es schließlich und Torrijos tötet Don Benito eigenhändig. Nach der Torrijos Machtübernahme wird das Buch zwischenzeitlich zu einer Art Kammerspiel, in dem es mit Akribie diverse Intrigen und Ränkespiele schildert. Zwischenzeitlich ähnelt das Setting von Ferne einem kleinen europäischen Königshof des 16. Jahrhunderts. Torrijos Macht wird von Jesuiten, Freimaurern und den "Großen" (Geldadel) bedroht. Und natürlich spielen auch die Frauen eine wichtige Rolle in diesen Ränkespielen. Zwei Dinge fallen in diesen zuweilen zähen Spielszenen auf: Zum einen ist Torrijos auch als Machthaber ein durchaus menschlicher Herrscher, eine Art "guter König", der sich als Mestize auch den Indios und den Armen in der Bevölkerung verpflichtet fühlt und ökonomische Verbesserungen erreichen möchte. Zum anderen ist die einzige Figur, der der Militärmachthaber vertrauen kann der Gitarrenspieler Felipe, der ungeachtet aller Entwicklungen stets loyal zu Torrijos steht. Der Höhepunkt der diversen, stets scheiternden Verschwörungen ist ein initiierter Indio-Aufstand, den Torrijos widerwillig blutig niederschlagen muss. Schließlich gelingt es Felipe nach einigen Verwicklungen, auch dieses Komplott aufzudecken. Die Schuldigen werden gefunden; bleiben aber überraschenderweise verschont. Im vierten und letzten Kapitel, das mehr als 20 Jahre nach der ersten Szene spielt, besucht Torrijos mit Felipe einen mystisch-heiligen Ort: den Titicacasee. Torrijos opfert hier sein Pferd, gibt danach seinen Herrscherposten auf und verlässt das Land (die Nachfolge hatte er vorher geregelt) in Richtung Amazonas. Für Felipe soll in der Hauptstadt gesorgt sein. Am Ende weinen die beiden ein bisschen; die einzige Kitschszene im Buch. Der Roman hat literarische Schwächen. Aber wenn schon Laux das Frühwerk von Drieu heranzieht, so wäre ein Hinweis auf dieses Buch angebracht gewesen. "Der bolivianische Traum" ist eine auf mehreren Ebenen angesiedelte Parabel. Da ist zunächst die Ambivalenz des Künstlers, der sich mit der (politischen) Macht einlässt. An einer Stelle gesteht sich Felipe, dass er sein Künstlertum durch die Beschäftigung mit den politischen Verstrickungen verloren habe. Schließlich zeigt Drieu wie die autokratische, absolute Macht trotz ihrer Absolutheit nahezu wirkungslos bleibt was die politischen Auswirkungen angeht. Der Krieg, den Torrijos führte um einen Meerzugang zu erreichen, ging verloren. Über eine Verbesserung der Lebensbedingungen des Volkes wird nichts bekannt. Stattdessen verlieren sich beide am Ende im Theoretisieren über Religion. Hier zeigt sich, wie gut gewählt der deutsche Titel war: "Der bolivianische Traum". Dieser ist gescheitert und nicht aufgrund der Intrigen oder Komplotte. Es ist die nicht sichtbare, aber virulente Machtlosigkeit in der Macht. Sich dem Leben hingeben Aber der Roman ist auch eine Geschichte über Empathie und Loyalität (die das Gegenteil von blindem Gehorsam ist). Etwas, was Drieu vermutlich zeit seines Lebens für sich gewünscht hatte, aber niemals aufbringen konnte. Zum dritten hat er am Ende der letzten Geschichte, recht gut versteckt, eine Art Testament seiner Lebensphilosophie hinterlassen und das hat es in sich: "Der Mensch wird nur geboren, um zu sterben, und nie ist er so lebendig, wie wenn er stirbt. Doch sein Leben hat nur einen Sinn, wenn er sein Leben hingibt, statt darauf zu warten, daß es ihm genommen wird." Im richtigen Leben sah Drieu dann paradoxerweise nur noch im Kommunismus eine Chance, die verhasste europäische Bourgeoisie zu beseitigen. In seiner destruktiven, fatalistischen Weltsicht voller Selbsthass hatte der Faschismus, hatten die Nazis versagt. Drieu ist am Ende: "Die Verachtung, die ich für mich selber habe, ist unmöglich und führt mich in dunkle Abenteuer", steht in seinem Tagebuch. Schon früh spielte er mit dem Gedanken an den Suizid. Als im März 1945 die Verhaftung wegen Kollaboration drohte, gibt Pierre Drieu la Rochelle sein Leben hin. Er nahm eine hinreichende Dosis Gardenal und drehte die Gashähne auf. Wichtig und treffend ist Laux' Differenzierung von Drieu zu Jünger, der die "aufkommenden Techniken" (und damit auch das, was man Moderne nennt) mit kritischer Sympathie begleitete und zum Teil bewunderte, während Drieu im Tagebuch von einer "planetarischen Katastrophe" jammerte. Dabei fällt einem sofort ein Widerspruch auf, denn Drieu war ja das, was man einen modernen Erzähler nennen könnte, hegte einst Sympathien für den Surrealismus. Und er inszenierte sich mal als Dandy und ein andermal als seriösen Autor. Nichts ist eindeutig bei diesem Mann und auch das ist ein Zeichen der Moderne, die er so verabscheute und unter der er litt. So nützlich die Bemerkungen durch Endnoten in den Erzählungen sind, so paternalistisch wirkt Laux' Bilanz. "Prekäre Intellektuelle" nennt er jene üblichen Verdächtigen wie Gottfried Benn, Knut Hamsun, Louis-Ferdinand Céline (die Liste ließe sich beliebig erweitern) und eben auch Pierre Drieu la Rochelle. Der Leser solle sich nicht "irremachen" lassen von Drieus "Ausfällen" heißt es dort. Eine "Lizenz zum 'Überlesen' problematischer Textstellen" gebe es nicht. (Wer hat das behauptet?) Dies vorausgesetzt sei eine "Rezeption vorstellbar". Dabei beruft er ich auf die Herausgeber der "Pléiade", die Teile von Drieu la Rochelles Werk mit der Maßgabe kritischer und profunder Erläuterungen in ihren Kanon übernahmen. Da sind sie wieder, die spitzen Finger, mit denen Drieus Bücher spätestens ab Mitte der 1970er Jahre auch in Deutschland angefasst wurden, wie ein Text von Hanns Grössel von 1980 zeigt. Aber ist die Vorsicht vor dem "falschen Lesen" nicht ein bisschen auch Angst vor der (eigenen) Courage? Wie wäre es, ein bisschen Vertrauen in Lesende zu setzen? Von einer "Verführung" für rechtes Gedankengut ist man bei Drieu weit entfernt und zu Recht betont Laux ja, dass es in seinen Büchern keine antisemitischen Ausfälle wie beispielsweise bei Céline gibt. Selbst politische Gegner attestierten ihm Stil und Könnerschaft. Und zur Not bleibt noch Sartres Psychologisierung. Drieus Bücher sind weit mehr als nur zeithistorische Zeugnisse. Und ja, es ist schon klar: "Die Komödie von Charleroi" kommt garantiert nicht ins "Literarische Quartett" des ZDF. Wer Unterhaltung und Entspannung sucht, liegt hier falsch. Wer in menschliche Abgründe blicken will, bekommt einiges geboten. Wenn man mit Drieus Lektüre zu Ende ist, fängt es erst an...Artikel online seit 05.07.16 |
Pierre Drieu la Rochelle |
||
|
|
|||
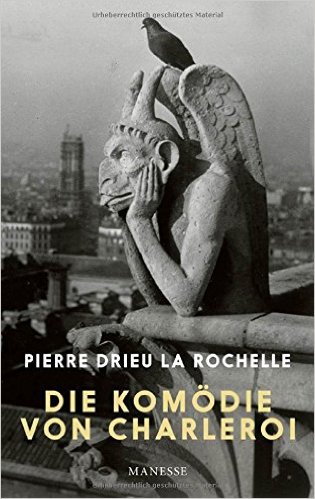
 Sein
Roman »Der bolivianische Traum«,
Sein
Roman »Der bolivianische Traum«,