|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 25.09.13 Der Artikel als pdf-Datei |
Zwei neue Biographien zum
100. Geburtstag von Albert Camus. |
||
|
Es gilt den 100. Geburtstag eines der großen Literaten des 20. Jahrhunderts zu feiern: Albert Camus. Und wie so oft geschieht dies mit neuen Biographien, Leseinterpretationen, womöglich sogar Enthüllungen, die - alle gut gemeint - das Werk in Erinnerung rufen sollen. Bei Camus scheint dies tatsächlich fast notwendig zu sein, denn er starb jung - mit 46 Jahren bei einem Autounfall. Das war 1960. Die existentialistische Welle, die er (und sein Widersacher Sartre) auslöste, beeinflusste zwar noch bis in die 80er Jahre hinein Literatur, Drama und Film, geriet danach jedoch mehr und mehr in Vergessenheit oder - was oft gleichbedeutend damit ist - verstaubt im ästhetischen Kanon als exotische Beilage einer sich ansonsten in der Beliebigkeit sonnenden Postmoderne. 1999 wurde die einige Jahre zuvor in Frankreich publizierte, ausladende Camus-Biographie von Olivier Todd in Deutschland veröffentlicht. Todd hatte 15 Jahre in Frankreich und Algerien recherchiert und hunderte von Zeitzeugen befragt. Die über 900 Seiten starke Biographie amalgamierte nun diese Recherchen mit Werkzitaten und Tagebuchnotaten von Camus. Im Präsens geschrieben entstand ein dichtes Lebensbild; wenn irgend möglich wählte Todd die dialogische Form, so als sei man mit dabei in den Salons, Redaktionsstuben oder am Schreibtisch. Da wurde das Leben dieses Mannes en détail rekonstruiert. Jedes noch so unscheinbares Detail wurde ausgebreitet - nur Camus' Liebesleben blieb weitgehend diskret im Dunkeln und auch die Anonymität der »Mi« genannten Geliebten hielt Todd. Letztlich berstet das Buch jedoch vor Material-Überfülle, die zuweilen den Blick auf das Wesentliche verstellt. Hinzu kam, dass Todd zwar durchaus interessante Deutungen aus Camus' literarischen Werken vornahm, aber mit den philosophischen Theorien seine Schwierigkeiten hatte. Biographie und Werkschau Iris Radisch, Romanistin und »Zeit«-Redakteurin hat nun im Jubiläumsjahr eine neue, gestraffte Biographie mit dem schönen Titel Camus - Das Ideal der Einfachheit geschrieben. Auf rund 300 Seiten schildert sie Leben und Werk von Albert Camus. Dabei hat sie ihre zehn Kapitel, in denen sie das Buch unterteilt, nach den zehn Lieblingswörtern von Camus benannt: »Die Welt, der Schmerz, die Erde, die Mutter, die Menschen, die Wüste, die Ehre, das Elend, der Sommer, das Meer« (nur die Reihenfolge ist eine andere). Eine hübsche Idee. Im Epilog erzählt sie von ihren Gesprächen mit den Kindern von Camus'. Aber es gab hier wenig Substanzielles; kaum Anekdotisches. Beide verehren und verklären ihren Vater. Am Ende bekommt Catherine Camus dann eine Nachhilfestunde von Iris Radisch über Albert Camus. Radischs Biographie geht weitgehend chronologisch vor. Da ist die Vaterlosigkeit, die karge Kindheit die heute als »traumatisch« subsumiert würde - mit der schweigsamen Mutter und der resoluten Großmutter. Dann die Förderung durch den Lehrer, die zum Besuch des Gymnasiums führt. Die seit der Jugend lebenslange, in Schüben immer wieder ausbrechende Lungen-Tuberkulose. Das Philosophiestudium in Algier, Diplomarbeit über Neuplatonismus und Christentum, das Fühlen als Algerienfranzose, die Liebe zur gleißenden, lichtdurchfluteten Landschaft. Die fast überstürzte (erste) Heirat und das politische Engagement in der kommunistischen Partei Algeriens nebst früh aufkommenden Zweifeln an der Ideologie. Aus gesundheitlichen Gründen kann Camus nicht die geplante Lehrerausbildung fortsetzen. Er wird Journalist, publiziert erste Erzählungen. Immer wieder pendelt er zwischen Algerien und Frankreich; in Paris wird er nie heimisch werden. Mit 28 hat er den Werkzyklus des Absurden beendet: Der Fremde - die Erzählung, Der Mythos des Sisyphos - der Essay, Caligula - das Theaterstück. Zweite Heirat, 1945 werden die Zwillinge geboren. Camus ist ein Frauenheld, hat eine Frau und häufig mehrere Haupt- und Nebengeliebte. 1947 erscheint Die Pest. Schließlich 1951 der Mensch in der Revolte und Camus' Dualismus, politisch motivierte Gewalt einerseits zu verdammen, andererseits jedoch für fast pflichtgemäß notwendig zu erachten. Es sei ein »Missverständnis«, so Radisch den Essay als philosophisches Buch zu sehen. Es sei »ein Buch über den Massenmord im 20. Jahrhundert, das Dichter und Denker als Wegbereiter« anklage. Camus rechne vor allem mit dem »deutschen Denken« ab (Nietzsche, Marx, Max Stirner), insbesondere jedoch Hegel, wobei Radisch richtigerweise erwähnt, dass es die französische Rezeption durch Kojève ist, die das Hegel-Bild der französischen Intellektuellen prägte. Das ist zwar alles auch intendiert, aber reduziert den Text - wie man noch sehen wird. Camus' Essay führt zum Bruch mit Sartre und seinen Freunden. Ausgiebig schildert Radisch das Verhältnis zu René Char, der ab Mitte der 1950er Jahre eine sehr wichtige Bezugsperson wird und den Freund aus Widerstandszeiten, Pascal Pia, »ersetzte«, nachdem sich Camus mit ihm überworfen hatte. Die Schreibblockaden von Camus' und dass dieser den Nobelpreis 1957 nicht als Votum seiner Position werten und mit einer gewissen Befriedigung zur Kenntnis nehmen konnte sondern in Angstzustände und Depressionen stürzte, erscheint ihr etwas übertrieben. Nach vielen Jahren Suche findet Camus 1958 ein Haus in Lourmarin, in der Nähe von Char. Hier möchte er sein »einfaches Leben« führen, in einer »Prachtimmobilie eines weltbekannten Schriftstellers, Nobelpreisträgers, Millionärs« wie Radisch mokant bemerkt. Hier macht er sich an das Manuskript zum Ersten Menschen, und zwar »mit fliegender Hand«. Man wird es aus dem Wrack, in dem er 1960 tödlich verunglückt, unversehrt bergen. Dass Radisch mit einer gewissen Lässigkeit Todds Buch ausweidet (es sind mehr Stellen als die 15 Endnoten, die genannt werden) mag man hinnehmen. Problematischer ist es schon, den mehr als 30 Jahre nach seinem Tod 1994 publizierten Roman Der erste Mensch, ein unfertiges, nur teilweise von Camus überarbeitetes Manuskript, als Tatsachenquelle zu verabsolutieren. Apodiktisch heißt es: »Man darf bei diesem Buch getrost vergessen, was man über die Unterscheidung von Autor und Figur gelernt hat, denn für dieses Buch ist das alles nicht gültig«. Ein Weg, den leider schon Todd beschritten hatte. Indem Radisch nun die Fiktionalität des Textes aufhebt, manifestiert sie erst die Idyllisierung, die sie Camus vorwirft. Nonchalant wird der Fragment-Charakter des Manuskript-Torsos übergangen. Radisch erwägt gar nicht, ob und wie Camus seinen Text noch verändert hätte. Im Marietta-Slomka-Jargon Eindringlich schildert Radisch die Kälte von Camus' Mutter, einer Frau mit allen Anzeichen einer Depressiven, die sie jedoch zeitgeistgemäß »im abseits des Autismus« sieht (vermutlich meint sie Solipsismus). Viermal wird sie pejorativ als »Analphabetin« bezeichnet und zweimal sind Albert und Lucien Camus dezidiert Söhne einer »Putzfrau«. Nicht die einzigen Beispiele für die zwangsoriginell daherkommende Besserwisser-Arroganz Radisch im Marietta-Slomka-Jargon. Die Intervention von Camus' erstem Lehrer und Förderer, der phänotypisch als »eine Provinzausgabe von Marcel Proust« beschrieben wird (was überflüssig ist, da es ein Bild gibt), kommentiert sie wie folgt: »Ohne Louis Germain gäbe es keinen Camus. Er wäre in irgendeiner Abstellkammer des Lebens gelandet.« Als abschreckendes Beispiel dient dabei der Metzger und von ihr als Freizeit-Intellektueller verspottete Onkel von Camus, bei dem er einen Teil seiner Jugend verbringt. (Da lobt man sich Todds souveräne Leichtigkeit in der Beschreibung dieses Onkels.) Die frühen Werke von Camus ähnelten »seinen Anzügen«, so Radisch: »Mann und Werk sind herausgeputzt und hochfahrend.« Als Camus in die USA fährt hat er nicht einfach »zwei Vorträge« im Koffer, sondern diese sind »zum Wechseln«. Im Tagebuch, so die Biographin, »pflegt er [Camus] den Mythos des Dachstubeneremiten«. Einfach störend auch die ständigen Hinweise auf den Unfalltod, eine Art Countdown des Restlebens, so als hätte Camus davon irgendeine Kenntnis besessen bzw. die Lebensgeschichte sei mit einem Fatum (oder Schlimmeres) verbunden. Dürftig die Journalisten-Superlative zu Camus' Büchern: eines ist sein »ehrlichstes« Buch (Der Fall), Heimkehr nach Tipasa zählt zu seinen »schönsten« (d'accord!) und Der erste Mensch sein »wichtigstes« (was streng genommen bedeutet, dass zu seinen Lebzeiten nur Nebenwerke erschienen sind). Es kann als sicher gelten, das Radisch sich im Kreis derjenigen sieht, die Der erste Mensch als »eines der Meisterwerke des 20. Jahrhunderts« sehen. Wie kann dies aber sein, wenn es ein Tatsachenbericht sein soll? Die Kriterien für diese Einschätzungen bleiben außer bei Heimkehr nach Tipasa eher diffus. Peinlich, das Verhalten der Protagonisten mit dem Blick und dem Wissen der Jetztzeit zu messen und in moralinsaure Gewässer zu fischen. Als Jean Grenier, »Camus' Förderer, Ratgeber, Lektor und Lehrer« 1942 einen Lehrstuhl in Lille bekommt, weist Radisch darauf hin, dass er diese Position aufgrund »der deutschen Judengesetzgebung« bekommen habe und suggeriert, in dem sie auf die fortwährende Korrespondenz zwischen Grenier und Camus hinweist, dass Camus dies irgendwie gerechtfertigt hätte. Der Briefwechsel sei ein »Meisterwerk der Unverbindlichkeit« gewesen. Es ist schon ein Jammer, dass man Iris Radisch damals nicht fragen konnte, wie man gefälligst zu korrespondieren habe. Tendenziös Geradezu tendenziös wird es, wenn sie im Unterkapitel »Ein Erfolg von deutschen Gnaden« Camus (und auch Sartre) vorwirft, dass während der deutschen Besatzungszeit in Frankreich ihre Bücher die Zensur passierten. Camus stimmte zwar Gaston Gallimards (seines Verlegers) Ansinnen, das Kapitel über den Juden Kafka aus dem Sisyphos-Essay zu entfernen, zu, damit das Buch erscheinen kann. So weit, so schlecht. Der »aufrechte« Pascal Pia plädierte dafür, das Buch unverstümmelt in der Schweiz erscheinen zu lassen. Aber Camus' »ausgeprägte Empfindsamkeit für die Fragen von Ehre und Moral« hätten hier geschwiegen, so Radisch triumphal. Bei Todd kann man die ganze Geschichte nachlesen. Dabei stellt man fest, dass Radisch zweierlei verschweigt: Erstens war Camus krank in Algerien, als sich diese Frage stellte. Der Verlag stand unter Druck; das Papier war kontingentiert. Tatsächlich hat sich Pia darum bemüht, das Buch mit dem Kafka-Kapitel außerhalb des besetzten Frankreichs erscheinen zu lassen. Aber Camus wollte, dass das Buch dort erschien, wo auch kurz zuvor »Der Fremde« veröffentlicht wurde. Er hatte zudem André Malraux, damals das intellektuelle Gewissen Frankreichs, auf seiner Seite. Camus wusste durchaus, wie Gallimard zwischen Anpassung und Widerstand balancierte. Und daher war es für ihn wichtig, dass der Verlag die durch die deutsche Besatzung verfemten Autoren nicht einfach fallen ließ. Bis auf wenige Ausnahmen standen sie auf einer Honorarliste des Verlags und erhielten monatliche Zuwendungen. Und Gaston Gallimard wehrte sich erfolgreich, Schriften von Jean Luchaire, dem Vorsitzenden des mit den Deutschen kollaborierenden französischen Presserats, zu verlegen. Luchaire wurde 1946 hingerichtet. Oberster Zensor in Paris war der deutsche Romanist Gerhard Heller, der in Paris in den literarischen Salons ein und ausging. Exemplarisch nennt Radisch »die prachtvollen Champagner-Empfänge der reichen Amerikanerin Florence Gould«, an denen unter anderem Friedrich Sieburg, Ernst Jünger und Jean Cocteau teilgenommen hätten, während »auf den Straßen jüdische Kinder nach ihren Eltern schrien und Zehntausende deportiert wurden.« Eine suggestive Stelle. Bei Todd kann man nachlesen, dass Camus und auch Sartre diesen Salon (und auch andere, ähnlich »besetzte« Zusammenkünfte) nicht frequentiert haben. Die Tatsache, dass ihre Bücher unter der deutschen Zensur erschienen deutet Radisch indirekt als Kollaboration. Kein Wort von ihr, dass Gaston Gallimard nach dem Krieg in einem Prozess vor einem französischen Gericht von diesem Vorwurf freigesprochen wurde - übrigens nicht zuletzt aufgrund einer Aussage von Camus. Auch das steht bei Todd. Schließlich kommentiert sie die Tatsache, dass Camus erst Ende 1943 in die Résistance eintrat (als »Chefredakteur« des gaullistischen Widerstandsblatts Combat) mit einer gewissen Süffisanz, um dann noch nachzulegen: In seinen Artikeln für die Résistance-Zeitschrift gebe es »kein Wort von ihm über Auschwitz.« Am Ende mutet es fast schon zwanghaft an, wie hyperkorrekt Radisch die moralische Lichtgestalt Camus ein bisschen ankratzen möchte, wobei dieser allerdings niemals entsprechende Ansprüche erhoben hat. Schlechter weg kommt bei ihr nur noch Sartre. Zwar ist es interessant, wenn Radisch den Roman eines Schicksallosen des Holocaustüberlebenden Imre Kertész und seine »Sprache für das Unsagbare« von Camus geprägt sieht und hier Anknüpfungspunkte entdeckt, aber ob das kleine Unterkapitel mit »Sisyphos in Auschwitz« nicht eine Spur zu effekthascherisch überschrieben ist, muss man sich schon fragen. Camus und Algerien Zu Camus' politischen Ansichten zu Algerien, einem Land, das er immer als seine Heimat betrachtet hat, angeht, fährt Radisch einen Schlingerkurs. Einerseits erläutert sie durchaus mit Sympathie die »Mittelmeer-Utopie« der französischen Intellektuellen, mit der auch Camus mindestens teilweise sympathisiert. Es ist jenes »mittelmeerische Denken«, die »antiwestliche Lebenskunst«, die sich wunderbar mit der »Schule der Enthaltung«, und der »Ästhetik der Einfachheit« kombinieren lässt. Instruktiv, wie Radisch diese in großen Zyklen immer wieder einmal aufkommende Utopie erläutert. Der Leser wundert sich, dass nicht die Keule des antimodernistischen Affekts geschwungen wird, welche die Autorin sonst so gerne schwingt. Andererseits wird Camus spätestens in den 1950er Jahren mit den politischen Realitäten konfrontiert. Er befindet sich in der schwierigen Lage, »den Kolonialismus abzulehnen, aber die Kolonisten zu verteidigen« und plädiert für einen dritten Weg, der ein föderales Algerien mit der Tolerierung der jeweiligen Volksgruppen vorsieht. Das historische Ergebnis ist bekannt; das Ergebnis für Camus kann man ausführlich bei Todd nachlesen. Nur dreimal fällt bei Radisch der Begriff Existenzialismus (mit z). Und dies derart geschickt, dass sich der Wunsch einer womöglich langwierigen Interpretation gar nicht erst einstellt. Das ist durchaus ein Glück, weil Radisch damit einer allzu bequemen Verschlagwortung entzieht, sondern sich lieber mit Camus' Vorstellungen vom einfachen Leben und der Gleichzeitigkeit von Schwermut, politischem Engagement, literarischer Kraft und Dandytum beschäftigt. Zumal Camus zu Lebzeiten all diese leicht gängigen Zuordnungen abgelehnt hatte. Er wollte nicht als Existentialist bezeichnet zu werden, weil er den Existentialismus à la Sartre für den Menschen fatal einschätzte. Er wehrte sich dagegen als Christ bezeichnet zu werden, wie auch gegen die Formulierung, er sei Atheist. Auch Philosoph sei er nicht, so zitiert Radisch ihn. Es ist immanent für Camus' Denken und Schreiben, dass die einfachen Schubladen nicht funktionieren. Radischs Ausführungen zu Camus' Philosophie sind kursorisch, aber keineswegs oberflächlich. Dezidiert erläutert sie, wie Camus sich weigert, die Gulags der Sowjetunion als Kollateralschäden für einen visionär-seligmachenden Sozialismus zu rechtfertigen. Kein gutes Haar lässt sie an Sartre und dessen hochfahrender Kritik an Camus, die sich schon beim Fremden zeigte, wobei Radisch sicherlich richtig einwendet, dass die Freundschaft zwischen den beiden nie eine echte gewesen sein dürfte. Es besteht kein Zweifel, für wen die Biographin Partei ergreift. Und dies obwohl sie - wie nahezu alle Kommentatoren bei dieser Gelegenheit - Sartres Unverschämtheiten noch mit dem Attribut der Brillanz glaubt versehen zu müssen. Für Sartre blieb Camus immer ein »algerischer Gassenjunge«. In der Linken wie in der französischen Klassengesellschaft haben solche Attitüden bis heute Tradition. Daher ist es schade, dass Radisch die aktuellen Bemerkungen des Bellizisten Bernard-Henri Lévy zu Sartre und dessen Invektiven in Bezug zu Camus nur in den Endnoten statt im Text untergebracht hat. Es wäre wichtig zu zeigen, wie beschränkt (und gleichzeitig durchaus politisch einflussreich) die Sartre-Adepten heute noch sind. Michael Meyers »Lesekompass« Einen anderen Schwerpunkt setzt der Feuilleton-Chef der »Neuen Zürcher Zeitung«, Michael Meyer mit seinem Buch Albert Camus - Die Freiheit leben, das er »Lesekompass« nennt; ein hübscher, auf den zweiten Blick doppeldeutiger Begriff. Meyer skizziert nur zu Beginn seiner sechs Kapitel auf je anderthalb Seiten in kursiver Schrift die Lebensumstände von Camus. Ansonsten widmet er sich detailliert und konsequent der Literatur und der Philosophie. Demzufolge ist die Ordnung nicht streng chronologisch, sondern thematisch. Es beginnt mit dem »Sprung ins Absurde«, widmet sich dann der »Welt von Unheil« (das besetzte Frankreich; Die Pest) und schließlich der Philosophie der Revolte nebst der entsprechenden Rezeption. Dem Journalisten und Tagebuchschreiber Camus sind weitere Kapitel gewidmet, bevor dann ein Blick auf die »Späte Prosa« das Buch beendet. Meyer verknüpft das Absurde mit Camus' Freiheitsbegriff. Dabei hebt er Camus' frühe Prägung durch seine Beschäftigung mit der Verknüpfung von griechischer Metaphysik und christlicher Theologie hervor. Camus sieht nach Meyer das »frühe Griechentum…als eine Haltung der Hinnahme der je eigenen Existenz sowie als Einwilligung in die Endlichkeit des Daseins«. Die christliche Erlösung negiert Camus ausdrücklich. Der Mensch ist demzufolge zu einem »Leben ins Jetzt« verurteilt. »Mit der Fähigkeit, über sich hinauszudenken, entstehen die Projektionen von Gegen- und Überwelten, in denen aufgehoben werden soll, was als Schicksal ohne Ausweg empfunden wird, Freiheit wäre indessen für Camus da erreicht, wo Raum und Zeit des Irdischen als zureichende Bedingung der Möglichkeit akzeptiert sind, sich selber zu finden.« Meyer weiter: »Freiheit ist gewonnen, wo der Mensch akzeptiert hat, dass die Welt zwar nicht schweigt, aber in ihren Wiederholungen an keinerlei 'Transzendenz' gebunden ist: Sie lädt den Sterblichen allein das Dasein im Hier und Jetzt auf« und »nach ihm ist Nichts«. Der emphatische Begriff der Freiheit Die eher dunkel konnotierte Vokabel des »Absurden« wird im emphatischen Begriff der Freiheit fortgeschrieben. Camus' Denken wird damit die Schwere genommen, und dies ohne Trivialisierung. Das Absurde führt Meyer erst wieder in der Abgrenzung zum Nihilismus ein: »Nihilismus überbietet die Vorstellung von der Absurdität der Welt noch insofern, als er zur völligen Indifferenz gegenüber dem Leben führt, dessen Wert sich in reine Gegenständlichkeit aufgelöst hat.« Und der Mensch, »der um die Kluft zwischen Welt und Dasein weiß, definiert sich am Ende widerständig als Komplize seiner Geworfenheit, indem er sie annimmt und über sie hinausgelangt. Doch der Nihilist hat solche Sensibilität hinter sich gelassen. Er agiert seelenlos als Vollstrecker im Namen der Geschichte.« Dieses Vollstrecken im Namen der Geschichte bildet den Kern des Dissenses zwischen Sartre und Camus. Sartre und seine Entourage sind bereit Mittel einzusetzen, weil der Zweck heilig ist. Meyer arbeitet heraus, warum dies für Camus nicht verfängt, denn wo »Messianismus, sei es säkularer, sei es religiöser Provenienz, die Gegenwartspflicht in Visionen des 'jenseits' aufhebt, wird der Mensch um sein reales Dasein gebracht. Er ist nicht mehr Subjekt, sondern Objekt eines Wissens, das Glück und Sorge deshalb geringschätzt, weil 'später' alle Probleme gelöst sein werden.« Kompliziert wird die Sache, wenn Camus den Mensch in der Revolte zu denken beginnt. Die Revolte ist kollektiv: »Ich empöre mich, also sind wir.« Meyer arbeitet sehr schön heraus, dass die Revolte für Camus »untrennbar mit dem Christentum liiert« ist. Das Problem der Theodizee, also eines Gottes, der das Leid zulässt, bringt das Christentum für ihn dauerhaft in Misskredit. Die Lösung sieht Camus dann im griechischen Denken: »Revolte ist…zunächst Kritik am Gewöhnlichkeitspathos und seinen bürgerlichen Verkörperungen, dann auch Askese, stets den Abstand davon zu wahren, und schließlich der beharrliche Effort, vergangene Größe, wie sie noch die alten Griechen in ihrem begeisternden Fatalismus gepflegt hatten, zu restituieren.« Sofort stellt sich das Problem, zwischen Revolte und Revolution zu unterscheiden. Eine Revolution, womöglich noch gewalttätig, lehnt Camus ab. »Der Idealismus einer Revolte erweist sich noch darin, dass er Maß und Grenze kennt […] während die Berufung auf die Revolution…jegliche Moral abgestreift hat.« Es ist dieses »Maß«, das für Positivisten wie Sartre ein willkommenes Einlasstor nicht nur für Kritik, sondern auch Spott und Häme ad hominem bieten wird. Nüchtern werden die Repliken Sartres und seiner Adepten ohne Parteilichkeit referiert. Meyer konzediert, dass Camus' Argumentationsführung eher »blass« geblieben ist. Was Meyer jedoch spür- und lesbar Respekt abverlangt ist Camus' »Distanz zu Lagern jeglicher Couleur« - sowohl spiritueller wie politischer Ausrichtung. Den Jenseitsversprechungen des Christentums misstraut er genau so wie den Diesseitsutopien von rechts und links, die sich geschichtsphilosophisch legitimieren und dafür »vorübergehend« Exzesse in Kauf nehmen. In diesem Sinne ist Camus von einer monumentalen Konsequenz, die auch vor den idealistischen Geschichtserzählungen beispielsweise der französischen Revolution nicht Halt macht. Der Ernst des Arbeiters Meyer entdeckt im Tagebuchschreiber Camus den »Ernst des Arbeiters« und die »Unbestechlichkeit der Wahrnehmung« (man vergleiche dazu Radischs Vokabular). Hervorzuheben sind seine Anmerkungen zur »Pest« und ganz besonders zum eher unbekannteren Buch »Der Fall«, welches ein gerüttelt Maß zum Nobelpreis beigetragen haben soll. Nicht nur hier weist Meyer auf eine starke ironische Haltung bei Camus hin. »Camus' Waffe blieb…eine Ironie, die bevorzugt mit sich selber ins Gespräch kam.« Abermals wird so dem Werk die mit der Zeit angedichtete Schwere abgenommen wie ein Restaurator die Patina auf einem älteren Gemälde entfernt. Der Protagonist des Romans, der eigentlich ein Monolog ist, heißt in der deutschen Übersetzung Jacques Clamans. Er ist so etwas wie der »negative Übermensch«. Meyer lehnt die Deutung ab, Clamans sei ein Abbild von Camus, wobei er Todd dies unterstellt. Todd deutet jedoch Clamans als Camus und Sartre. Damit führte Camus, so Todd, »die Pariser Kritiker wie ein tintensprühender Kraken in die Irre«, wobei sich am Ende der Deutungskreis der Ironie bis hin zum Sarkasmus wieder schließt. Camus' journalistische Arbeit ist fast immer politisch; engagiert. Bekannt sind vor allem die Briefe an einen deutschen Freund, der Essay gegen die Todesstrafe und seine Engagement zur Algerien-Problematik. Immer mehr erkennt er dabei, dass sein Denken entweder mutwillig falsch verstanden wird oder seine Vorschläge verpuffen. Es stellen sich »periodisch Phasen der Resignation« beim »Getriebenen« ein. Camus sucht zunehmend »die Harmonie in und mit der Einfachheit«, also gegen die Intellektuellensalons im verhassten Paris. Meyer erläutert, dass Camus' Schreibkrisen nicht einfach nur Pose sind (es erscheinen ja durchaus Aufsätze und Erzählungen), sondern dass es sich um eher um eine Formkrise handelt: der »Ordnungssinn…schafft keine deutlichen Strukturen mehr«. Camus entwirft skizzenhaft Projekte, die dann nicht mehr weiterverfolgt werden, wie beispielsweise die Figur des »Don Faust«, Verführer und Erkenntnisforscher, Don Juan und Dr. Faust in einer Person. Tatsächlich widmet sich Camus ab 1958 dem Ersten Menschen, dem Manuskript, das sich im Unfallwagen unversehrt finden wird. »Nicht auszudenken, wenn der Text…zuschanden gekommen wäre« vermeldet Exeget Meyer ein bisschen betriebsblind. Meyer sieht Camus in diesem Manuskript »unterwegs zu sich selbst im Medium erzählender Prosa«. Der Name des Protagonisten – Jacques Cormery - erscheint unter zwei Aspekten interessant. Zum einen ist Cormery eine Paraphrase von »Comery«, dem Namen von Camus' Großmutter väterlicherseits. Zum anderen weist Todd darauf hin, dass die Initialen »J. C.« an Jesus Christus erinnern. Es ist Meyer, der immer wieder Hinwendungen von Camus zum Christentum über das philologische hinaus konstatiert. So hatte Camus im Tagebuch das Christentum als »menschliche Religion« bezeichnet, wenn man denn die letzten Seiten des Evangeliums herausreiße. Später habe er die »'zwischenmenschlichen' Verhaltenslehren des Neuen Testaments schon lange verinnerlicht«, ohne freilich dabei den Erlösungsgedanken des Christentums anzunehmen. Und im Kapitel über Die Pest zitiert Iris Radisch Camus aus dem Tagebuch, »als wollte der verlorene Sohn am Ende seines Weges doch noch zum Christentum finden, dessen Verstrickung in die abendländische Gewaltgeschichte er so oft beklagt hat.« Gibt es so etwas wie eine Kehre von Camus? Eine Versöhnung mit oder gar Hinwendung zum Christentum? Etwas, was nur den Unfalltod nicht mehr artikuliert werden konnte? Die Frage wird nicht ernsthaft erörtert; die Indizien nur protokolliert. Der Roman beginne mit einem "Krippenspiel", so Radisch leicht despektierlich. Es ist das Jahr 1913, Jacques Cormery wird geboren. Das Setting weist tatsächlich sehr große Ähnlichkeiten mit der christlichen Ikonographie der Geburt des Jesus-Kindes auf. Die Ärmlichkeit der Familie, die auf einem Karren daherkommt. Aus der Flucht nach Ägypten wird eine Flucht nach Algerien. Die Geburt findet in einem Weinanbaugebiet statt, es gibt Rebstöcke und Traubenmostgerüche. Eine Anspielung auf das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg? Oder nur der Tatsache geschuldet, dass Camus' Vater im Weinhandel tätig war? Immerhin gibt es für die Mutter eine Herberge, es ist eine Kantinenunterkunft mit fauligem Geruch. In den Vornotizen zum Buch, jenem öminösen Spiralbuch, schreibt Camus: »Christus ist nicht bis Algerien gekommen.« Ist Jacques Cormery gar der algerische Christus? Jahrzehnte später steht Jacques am Grab des in Frankreich 1914 im Krieg getöteten Vaters und rekapituliert dessen Abwesenheit und man erinnert sich an Christus' Klage: »Warum hast du mich verlassen« - so zitiert die Figur aus Camus' Fall den fehlenden Beistand Gottes und die potentiellen Zweifel des Gekreuzigten. Und da ist die Mutter, nach Meyer »stiller Mittelpunkt« des Ersten Menschen, die durchaus Züge der Gottesmutter trägt. Wie stark Camus mit der christlichen Symbolik spielte, zeigt sich an einer anderen Notiz: »Seine« - Cormerys - »Mutter ist Christus« steht dort. Als Titel hatte Camus längere Zeit »Adam« erwogen; der französische Originaltitel Le premier homme bedeutet ja streng genommen »Der erste Mann«. Die forcierte Entwicklung einer These hin zu einer Neubewertung des Christentums durch Camus unterbleibt. Meyer, der im literarischen Werk immer wieder Spuren von Dostojewski und Tolstoi herausarbeitet, sieht im Ersten Menschen in den zum Teil synästhetischen Erinnerungsleistungen Cormerys Anleihen bei Marcel Proust. Der Roman sei Literatur, die »zu Wahrheit, Schönheit und Moral im übergeordneten Sinne« vordringe. Gemeint ist anscheinend der bestehende Moralkontext. Meyer vermeidet die unmittelbare Gleichsetzung von Cormery mit Camus und erweitert damit die Interpretationsmöglichkeiten des Buches. Der Roman gehöre zu den »herausragenden Epen der Epoche«. Das dabei gelegentlich Einzug haltende Pathos subsumiert Meyer »vollkommen auf der Höhe des Unterfangens der 'Recherche'« von Proust. Iris Radischs Biographie ist auch, aber eben nur kursorisch, Werkbiographie. Das geschieht durchaus angemessen. Störend ist nur der aufgekratzte moralisierende Ton, mit dem die 1959 geborene arg verkniffen dem potentiell antimodernen Camus moralisches Fehlverhalten andichten möchte. Wer eine erste Übersicht über Camus sucht, ist hier dennoch gut bedient. Martin Meyers instruktives Buch fächert den Camus-Kosmos gekonnt und ohne Affektiertheit auf. Das ein oder andere überflüssige Fremdwort hätte man vermeiden können. Aber dass auch der bereits kundige Leser hier zahlreiche neue Aspekte entdeckt und auf Spuren geleitet wird, die Lust machen auf ein Nach- oder Neulesen, ist eine große Leistung Meyers. |
Iris Radisch
|
||
|
|
|||
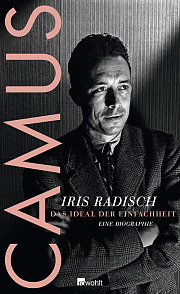
 Moralische
Lichtgestalt oder Getriebener?
Moralische
Lichtgestalt oder Getriebener?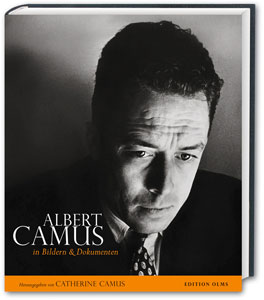 Der
wirkliche Mensch
Der
wirkliche Mensch