|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 25.08.13 |
|
||
|
Claude Lévy-Strauss hat 1962 in seinem Werk »Wildes Denken« den wundervollen Begriff »bricolage« geprägt. Für den französischen Ethnologe bedeutete er Bastelei, im übertragenen Wortsinne von Neuzusammenfügungen von Bestehendem, längst Bekanntem, Restbeständen oder achtlos Liegengelassenem. Oder in den Worte von Lévy-Strauss: »Nehmen und verknüpfen, was da ist.« Nicht viel anders versteht Steven Johnson den Begriff Innovation. Ein Prozess, der langsame Ahnungen und lose Ideen in die Realität überführt. immer sehr pragmatisch, oft sehr banal, manchmal sehr basal, Basteleien eben. Johnson demaskiert damit die Vorstellung des Genies, der kraft seiner intellektuellen Kapazitäten und seiner kreativen Vorstellungskraft Dinge aus dem Nichts neu erfindet. Genau so funktioniert es nur in den wenigsten Fällen. Vielmehr spielen Umgebung und spezifische Faktoren entscheidende Rollen. Johnson nennt sieben Begriffe, an denen er seine »kurze Geschichte der Innovation«, so der Untertitel, ausbreitet: Das Nächstmögliche, flüssige Netzwerke, die langsame Ahnung, Serendipität, Irrtum, Exaptation und Plattformen. Eine Kombination aus diesen Anordnungen schaffen die Voraussetzungen, um aus guten Ideen bahnbrechende Innovationen entstehen zu lassen. Was meint Johnson mit den jeweiligen Begriffen? In »Das Nächstmögliche« verweist er darauf, dass Neues stets aus Einzelteilen und Fähigkeiten entstehen, die an Ort und Stelle vorhanden und verfügbar sind. »Ideen sind wie Basteleien, zusammengebaut aus ebenjenem angestaubten Überresten des schon immer Dagewesenen«, wie Johnson schreibt (und damit indirekt direkt auf Lévy-Strauss verweist). Innovation ist damit natürlich auch auf das Vorhandene begrenzt. Ideen für eine Rechenmaschine mag es vor langer Zeit bereits gegeben haben, aber erst die spezifischen Voraussetzungen im 20. Jahrhundert haben es ermöglicht, so ein Ding wie einen Computer auch herzustellen. Und immer wieder neu zu erfinden. Die Kultur- und Technikgeschichte des Menschen ist eine Aneinanderreihung von Versuchen, das Nächstmögliche zu erkunden und auf dieser Grundlage die sich neu ergebenden Möglichkeiten auszuloten. Das heißt aber auch, dass es innovativer Umgebungen bedarf, das Nächstmögliche zu erkunden. Wie wichtig Umgebungen sind, spürt Johnson im Kapitel »Flüssige Netzwerke« nach. Darin beschreibt er eine gute Idee als Netzwerk. Es kommt darauf an, für eine vernetzte Umgebung zu sorgen. Idealtypisch steht hierfür das Gehirn, eine Organ, in dem es 100 Billionen Nervenverbindungen gibt. Das Beeindruckende am Gehirn ist zudem seine Eigenschaft der Plastizität. Es ist veränderbar, es verändert sich mit neuen Erfahrungen, neuen Ideen und Anregungen und schafft damit neue Verschaltungen, neue Möglichkeiten. Das heißt auch, wir sollten vernetzte Umgebungen schaffen, die die Voraussetzung schaffen, das Nächstmögliche auszuloten. Trotz aller Gefahren und Neigungen zum Chaos, die typisch sind für innovative Systeme. Es gilt eine Balance zu schaffen zwischen Chaos und Struktur; Ideen reifen zu lassen, aber auch über Wege zu verfügen, diese Ideen weiterzugeben. Selbsterklärend ist der Titel des Kapitels »Die langsame Ahnung«. Oft genug führen Ideen das lange Leben schwer zu fassender Ahnungen. Johnson verdeutlicht dies anhand der wissenschaftlichen Lebensleistung von Charles Darwin. Die Erfahrungen und Beobachtungen, die Darwin mit seiner Reise auf der Beagle 1837/38 gesammelt hat, werden erst in den folgenden Jahrzehnten zu den Erkenntnissen, die die Grundlage seiner Evolutionstheorie bedeuteten. Ideen benötigen Zeit, um sich zu entwickeln. Es besteht für sie aber auch die Notwendigkeit sich mit anderen Ideen und Erkenntnissen zu vernetzen. Genauso wie die Zeit benötigen Innovationen aber oft genug »glückliche Zufälle«, viel schöner ausgedrückt mit dem Begriff »Serendipität«. So angenehm sich dies anhört, gehören doch wieder mehrere Komponenten dazu: Zeit, Wissen, Vernetzung, Forscherdrang als Methode für glückliche Zufälle. Wie heißt es so schön: »Der Zufall begünstigt nur einen vorbereiteten Geist«. Wer nur zu Hause sitzt oder in seinem sterilen Büro, wird nur selten mit glücklichen Zufällen honoriert. Ähnlich wie der Zufall spielt auch der Irrtum häufig eine entscheidende Rolle im Laufe der Geschichte. Ob jede Erfindung eine »fortgesetzte Anhäufung von Irrtümern« ist, wie Johnson augenzwinkernd betont, sei dahin gestellt. Grundsätzlich sollten Fehler wesentlich positiver bewertet werden als bisher. Zumindest im Blick auf den Gesamtprozess. Schließlich erhöhen Irrtümer den Zwang zu forschen und nicht selten entstehen aus ihnen neue Erkenntnisse. In der Zwischenzeit werden Störfaktoren ganz bewusst eingebaut, um die Kreativität zu erhöhen. Oder wie es dem Leitsatz einiger »Web-Start-Ups zu entnehmen ist: »Fail faster«. Fehler sind nicht das gewünschte Ergebnis und bestimmt nicht das Ziel. Fehler geben aber den Push neue Wege zu gehen. »Exaptation« ist ein weiterer Begriff, den Johnson einführt. Es geht um Zweckentfremdung. In der Evolutionsgeschichte gibt es das Beispiel der Vogelfedern. Ursprünglich von Dinosauriern zur Wärmeisolation entwickelt, wurden Federn im Laufe der Evolution zum Fliegen exaptiert. Überhaupt besteht die Evolution aus einer vielfältigen Kombination von Mutation, Exaptation, Irrtum und Serendipitität zur Weiterentwicklung des Nächstmöglichen. Anhand Darwins Beobachtungen zum Korallenriff führt Johnson das Kapitel »Plattformen« aus. Darwin hatte die biologische Reichhaltigkeit eines Korallenriffs beeindruckt und daraus das »darwinsche Paradoxon« formuliert, wie eine so nährstoffarme Umgebung so viele ökologische Nische als Existenzgrundlagen für so reichhaltiges Leben bieten könne. Darwins Theorie zur Atollbildung ist bis heute anerkannt. Für ihn ist ein Korallenriff eine organische Plattform, deren Hügel, Platten und Spalten Lebensrauf für Millionen andere Spezies schafft. Korallen sind Ökosystem-Ingenieure, die Schicht um Schicht neue Möglichkeiten erschaffen. »Plattformbauer und Ökosystem-Ingenieure öffnen nicht nur Türen zum Nächstmöglichen, sie errichten ganze neue Stockwerke.«
Riff ist eine der Lieblingsbegriffe von Johnson, weil es eine Art und Weise
beschreibt, wie zusammengearbeitet und -gelebt werden kann und soll. Nicht
Wettbewerb, auch wenn Wettbewerb auch für Johnson eine zentrale Kategorie ist,
sondern Kooperation und die Fähigkeit zum Zusammenhalt sind die wesentlichen
Eigenschaften, das Nächstmögliche anzustoßen und Innovationen hervorzubringen.
So gibt ein Blick auf die wichtigsten Erfindungen im 20. Jahrhundert den
Aufschluss, dass nicht-Marktorientierte, aber vernetzte Umgebungen die
erfolgreichsten sind. In diesen »Hybrid-Ökonomien«, in denen Informationen frei
flottieren und Ideen sich unkontrolliert ausbreiten können, spielen die von
Johnson erarbeiteten Erfolgsfaktoren eine Schlüsselrolle. Diese Hybrid-Ökonomien
sind gerade in Großstädten als derzeit größte Plattform häufig zu finden. Es
liegt an ihrer kulturellen Vielfalt, an den Überlappungen verschiedenster
Gruppen und Subkulturen, die of einen unvorhersehbaren Austausch verschiedenster
Einstellungen, Motive, Werte, Ideen und Überzeugungen provozieren. Je größer
eine Stadt, desto kürzer die Zeitintervallen, in denen neue Ideen hervorgebracht
werden. Dem Physiker Geoffrey West zufolge ist der Durchschnittseinwohner einer
Fünfmillionenstadt fast dreimal kreativer als der Durchschnittseinwohner einer
Stadt mit 100.000 Menschen. Das hat aber nicht mit der Intelligenz der Masse zu
tun, sondern mit der Intelligenz Einzelner in der Masse. Es ist nicht die
Großstadt, die klug macht, aber der Einzelne kann klüger werden, weil er in der
Stadt mit vielerlei Personen und Gruppen verbunden sein kann. Denn Großstädte,
wie auch das World Wide Web, sind deshalb innovative Umgebungen, weil dort
schneller und bereitwilliger Informationen weitergegeben, ausprobiert, neu
verbunden und kombiniert werden. Die Großstadt als riesiger Hobbykeller.
Bricolage eben! |
Steven Johnson |
||
|
|
|||
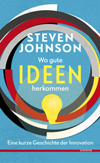 Sieben
Muster der Inspiration
Sieben
Muster der Inspiration