|
Termine Autoren Literatur Krimis Biographie Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Preisrätsel |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 01.03.13 |
Von Georg Patzer
|
||
|
Das fängt gar nicht gut an: Krieger lädt zu einer privaten Filmvorführung ein: »Nach dem, was er sagt, ist es was Japanisches, was echt Hartes. Und er versteht was davon. Das heißt, es ist nicht gerade 'Rashomon', wenn du verstehst, was ich meine. Mach dich auf einen Schock gefasst«, sagt Schoresch. Um fünf wollen sie bei ihm sein, aber dann finden sie die Straße nicht, in der Krieger wohnt. Sie irren umher, fragen Passanten und einen Taxifahrer, dann einen Polizisten, der es ihnen erklärt und dann fragt: »Zu Krieger?« Nein, der Besuch steht unter keinem guten Stern: Zuerst ist die Vorführmaschine kaputt, und sie müssen warten, bis Kriegers Sohn mit einem Ersatzteil kommt und es einbaut. Dann ruft Krieger seine Frau Sarka, die ihre Mutter im Rollstuhl ins Zimmer schiebt. Und dann sitzt die ganze Familie beisammen und schaut sich den Film an: ein Porno, der in Japan spielt. Aber kaum hat er angefangen, klingelt es an der Haustür: der Polizist. Und dann gibt es ein vollkommenes Durcheinander: Der 12-jährige Sohn verschwindet über den Balkon, Krieger behauptet, nicht zu wissen, was das für ein Film ist, denn Schoresch hätte ihn mitgebracht. Aber auch Schoresch gibt an, nichts zu wissen. Dann kommt ein zweiter Polizist, der den Jungen geschnappt hat, und der erste will jetzt auch den Film sehen. Die Vorstellung geht also wieder los, der zweite Polizist schläft sofort ein: Er leidet unter Narkolepsie. So geht es immer weiter in der Erzählung »Die Nachmittagsvorstellung« von Jehoschua Kenaz. Es ist das reinste Tohuwabohu. Ständig passiert irgendetwas Unvorhergesehenes, immer wieder will Schoresch, dem das alles peinlich ist, gehen, immer wieder schläft der Polizist ein, dann kommen noch zwei Freunde von Krieger, bis am Schluss auch noch das Polizeiauto gestohlen wird. Undurchsichtig ist es, einen rechten Sinn kann man nicht erkennen. In einer anderen Erzählung haben sich ein paar Leute in Rafis neuer Wohnung getroffen, zu einer kleinen Feier. Sie kennen sich alle nicht, kennen aber Bonaventura, der eingeladen hat, aber nicht da ist. Sie warten, essen, trinken, reden ein bisschen. Der Fernseher, den Rafi vor ein paar Tagen gekauft hat, funktioniert nicht, und auch das Radio rauscht nur. Immer wieder klingelt Frau Spitzer, eine Nachbarin, und beschwert sich darüber, dass jemand ins Treppenhaus gemacht hat. Und dann geht plötzlich die Haustür nicht mehr auf. Und dann geht auch die Tür zur Toilette nicht mehr auf. Als Riki sie aufbricht, liegt dort ein Mann mit einem japanischen Messer in der Hand: »Sein Gesicht war gräulich blass, und seine aufgerissenen Augen, herausgewölbt wie zwei Muscheln, starrten nach rückwärts, völlig ausdrucksleer, wie die Augen eines Fisches.«
Es ist eine absurde Welt,
in die uns Kenaz immer wieder hineinwirft. Manchmal ist alles normal mit kleinen
Abweichungen, wie in der Erzählung vom Soldaten, der gebeten wird, eine Schuld
für seinen Vorgesetzten zu übernehmen. Oder in der Erzählung vom alten Mann, der
einen Schlaganfall hat und auf einen launischen, hektischen Arzt trifft. All das
ist noch gut vorstellbar. Aber schon beim Mädchen, das die deutschen Lager
überlebt hat und jetzt spürt, dass zwischen ihren Fingern und am Ellbogen
»wildes Fleisch« wächst, Fleisch der Deutschen, das sie wegschneiden lassen
will, schon bei diesem Mädchen ahnt man den Wahnsinn. Nicht nur den des
Mädchens, sondern der Welt, des unberechenbaren, oft bösartigen Lebens. |
Jehoschua
Kenaz |
||
|
|
|||
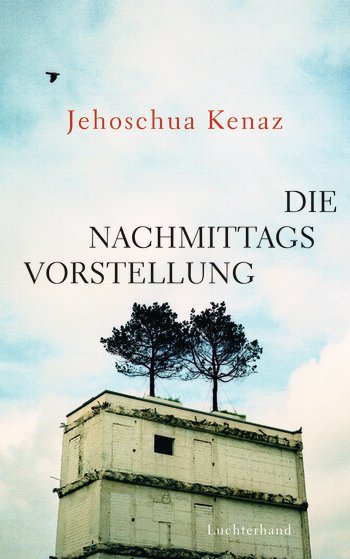 Nicht
sicher
Nicht
sicher