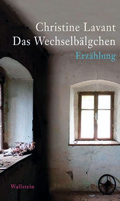|
Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 11.10.12 |
Von Lothar Struck |
||
|
"Wrga die Einäugige hatte ein Wechselbälgchen. Aber sie tat so, als ob sie das nicht wüsste und nannte das Bälgchen manchmal bei seinem schönen Namen." So beginnt die Erzählung "Das Wechselbälgchen" von Christine Lavant, einer österreichischen Schriftstellerin, die 1915 im Kärntner Lavanttal geboren wurde (daher das Pseudonym) und 1973 starb. Lavant stammte aus einfachen Verhältnissen und war eigentlich Strickerin. In den 1930er Jahren hatte die zeitlebens gesundheitlich Angeschlagene begonnen zu schreiben. Einige ihrer Gedichte und Erzählungen wurden veröffentlicht, vor allem im Otto Müller-Verlag in Salzburg. Aber trotz einiger Preise (zwei Mal den Georg-Trakl-Preis und 1970 den Großen Österreichischen Staatspreis) blieb Christine Lavant einem breiten Publikum bis heute nahezu unbekannt. Die Erzählung vom Wechselbälgchen, das den Namen Zitha trägt (eine Anspielung auf Zita von Bourbon-Parma?), erschien erst 1998, ein halbes Jahrhundert nach der Entstehung. Die jetzt neu von Klaus Amann herausgebrachte Ausgabe basiert auf einem 1997 entdeckten Typoskript, welches unter anderem auch von Christine Lavant selbst korrigiert wurde und seit 2006 im Musil-Institut zu Klagenfurt aufbewahrt wird. Die scheinbar sanfte Sprache (von Ferne an eine Melange aus oraler Märchenerzählung, Adalbert Stifter und Wilhelm Hauff erinnernd, aber dann doch ganz eigenartig), erzeugt, wenn man sich in den Rhythmus der Sätze erst einmal eingelesen und die Eigenheiten von Satzbau und Interpunktion erschlossen hat, einen ganz eigenen Kosmos, der den Leser tief eintauchen lässt. Direkte Zeit- und Ortsangaben gibt es nicht; mit ein bisschen Mühe kann man auf die 1920er Jahre in Kärnten schließen. Die lokalen Idiome und Ausdrücke werden dankenswerterweise in kleinen Fußnoten erläutert; das sie nicht zu Gunsten vielleicht einfacherer Lesbarkeit eingeebnet wurden, erweist sich schnell als Gewinn. Aber man täusche sich nicht: Hier wird kein Idyll evoziert, auch wenn das Wechselbälgchen Zitha, nicht nur unehelich geboren, sondern auch geistig zurückgeblieben, fast stumm (es lernt nur drei, vier Wörter stammelnd sprechen), womöglich verwachsen, von den "Keuschen-Kindern" (den Kindern der armen Bauern) gleichberechtigt und in ihren Möglichkeit in den Spielen integriert ist. Aber auch in diesen Momenten der kleinen Freuden gibt es in Lavants Prosa diesen balancierenden Ton zwischen schönem Augenblick und Bedrohung. Zunächst geschieht jedoch das fast Unmögliche: Die Glasäugige, durch das vermeintliche "Teufelskind" Stigmatisierte, findet einen Mann. Der Knecht Lenz, "von den gläsernen Grenzbergen" kommend, heiratet Wrga und steigt in der Dorfhierarchie zum Amtmann auf. Die gemeinsame Tochter Magdalena wird geboren; ein liebreizendes Wesen und Kontrast zum Wechselbälgchen. Lenz' scheint auch, was Zitha angeht, besänftigt. Er duldet das Wechselbälgchen und auch wenn es nicht am Tisch essen darf, verhungert es nicht. Der Leser erfährt, wie besonders dies sein muss, obwohl Lenz zunächst finstere Gedanken hatte. Da ist es, das Glück: "Sie kamen überhaupt gut miteinander aus, diese beiden ungleichen Geschwister und Wrga konnte manchmal ihr großes Erdenglück kaum erfassen, wenn sie die Kinder so sanft und freundlich vor sich spielen sah, wie richtige Herrschaftskinder in einer warmen und immer sauberen Stube." Aber hier nagt auch schon der Zweifel: "Zum Gernhaben und Schöntun hätte er, wie er gebaut ist, wohl eine Jüngere und Schönere bekommen, eine mit zwei richtigen Augen und ohne Anhang. Ja, das sah sie alles ein, alt und verständig wie sie war, nur dass Gott ihr auf die alten Tage sozusagen noch einen Mann mit Staatsanstellung und einem fast eigenen Haus geschenkt hatte, das begriff sie nie recht und es machte ihr oft viel Sorge." Am Ende der Erzählung verstärken sich Anzeichen für eine unglückliche Wendung. Umstände, an denen Lenz nicht unschuldig scheint (geschah es aus Vorsatz?) lassen Magdalena in den nahen Fluss stürzen. Und nun wird das Wechselbälgchen zur Heldin: Zitha rettet seiner Schwester das Leben, freilich um den Preis des eigenen Todes. Es ist ein zutiefst humanes Bild, welches Lavant hier von diesem angeblich zurückgebliebenen Individuum zeichnet. So wird aus der Erzählung vom "Wechselbälgchen" eine ergreifende Moritat, die einem – und das ist das merkwürdige – so schnell nicht mehr loslässt.
Es ist wunderbar, wie das ausführliche Nachwort von Klaus Amann den Zauber
dieser Erzählung nicht durch irgendwelche apodiktischen Deutungen nivelliert
(wie das doch so häufig der Fall ist), sondern im Gegenteil erst recht zum
Leuchten bringt. Da wird die Geschichte des Manuskripts, welches als Basis für
diese Neuedition diente, skizziert, biographisches zu Christine Lavant
ausgebreitet (inklusive eines sehr erhellenden Briefes an die dänische
Journalistin Maria Crone von 1957) und der literarische und auch geographische
Kontext aufgezeigt, in der sich diese Erzählung bewegt. Lothar Struck |
Christine Lavant Das Wechselbälgchen Erzählung Mit einem Nachwort von Klaus Amann Wallstein Verlag 106 Seiten 16,90 ISBN 9783835311473 |
||
|
|
|||