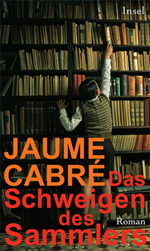|
Bücher & Themen

Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Glanz & Elend
empfiehlt:
50 Longseller mit
Qualitätsgarantie
Jazz aus der Tube u.a. Sounds
Bücher, CDs, DVDs & Links
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.»

|
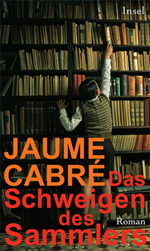 Bekenntnisse Bekenntnisse
Über Jaume Cabrés schwindelerregenden Roman »Das Schweigen des Sammlers«
Von Jürgen Nielsen-Sikora
Ein Sammler hält sich fest an
dem, was ihm lieb ist. Weil vieles so flüchtig geworden ist, unbekannt, exotisch
und nicht recht fassbar, benötigt er etwas, das ihm nicht entschwindet. Das
Sammeln von Dingen nimmt ihm die Angst vor dem Tod und tröstet ihn darüber
hinweg, dass er einsam ist. Dem Lauf der Dinge, dem immer gleichen Vergehen all
seiner Träume, diesem Herzschlag der modernen Welt, stemmt er sich mit seiner
Sammlung entgegen. Er ist bemüht, die Dinge dem Vergessen zu entreißen. Aber
nicht nur die Dinge. Auch sich selbst will er mit Hilfe des Sammelns
unvergesslich werden lassen. Er sucht nach Identität und multipliziert seine
Person in den Dingen, mit denen er sich umgibt. Sein Ich und die Dinge sind auf
geheimnisvolle Weise miteinander verbunden. Er ist, was er sammelt. Und wenn er
von den Dingen spricht, so spricht er doch im Grunde nur über sich. Er sammelt,
um sich selbst ein wenig näher zu sein, um sich besser verstehen zu können.
Immer ist Sammeln der
persönliche Kampf gegen ein Zeitalter der Zerstreuung und Zerstörung; eine
individuelle Form, das Chaos der eigenen Lebensgeschichte in Ordnung zu bringen;
eine Form der Erinnerung, des Zurückholens, der Konservierung.
Mit
seinen Sammlerstücken entdeckt der Sammler einen Teil der alten Welt wieder,
indem er die Dinge neu erwirbt, sie zu seinen macht und bestrebt ist, ihnen
Dauer zu verleihen. Vielleicht beschrieb der französische Schriftsteller Honoré
de Balzac die Sammler deshalb einst als die leidenschaftlichsten Menschen auf
der Welt und schuf in seiner La recherche de l`absolu von 1834 mit
Balthazar Claës eine Figur, deren zerstörerischer Wahnsinn und destruktiver
Charakter dem Wesen des Sammlers scheinbar entgegengesetzt ist. Claës wird
skizziert als ein positivistischer Alchimist, der alles dem Experiment
unterordnet, der die Tränen seiner Frau unter das Mikroskop legt und sie in den
Tod treibt. Er ist der Inbegriff einer gescheiterten Existenz.
„Die Vorfahren von Balthazar Claës waren Sammler“ kommentiert Walter Benjamin.
Diese überraschende, auf den ersten Blick irritierende, Aussage wirft die Frage
auf, ob es eine Verwandtschaft zwischen Sammlung und Zerstörung gibt. Der
Sammler versucht einerseits, die Welt wieder in Ordnung bringen, sie
auszubessern, zu flicken, zu erneuern und eine verloren gegangene Nähe
herzustellen. Doch es gibt ein geheimes Band zwischen dem, was kaputtmacht und
dem, was seine Sammlung umhütet. Denn Balzacs Protagonist, der sich um die
kleinen Dinge des Lebens sorgt, verliert das große Ganze aus den Augen. Und so
stürzt am Ende auch die Welt der positiven Befunde zusammen. Bei Balzac dringt
einer in die Mikrosphäre der Welt ein, während um ihn herum alles zerfällt,
verdampft oder sich auflöst.
Der Sammler versucht, das Chaos zu überwinden, indem er sich bestimmten Dingen
widmet. Aber eben nur bestimmten. Er konzentriert sich auf die
Nebensächlichkeiten der eigenen Interessen und Vorlieben und verliert so den
Blick auf die Zusammenhänge. Sein Versuch, das Chaos zu überwinden, schafft nur
neue Unordnung. Er muss letzten Endes scheitern. Denn sein Versuch der
Neuanordnung, der Wiedererschaffung einer untergegangenen Welt bleibt
uneingelöst, weil seine Sammlung die Brücke zum gesellschaftlichen Gesamtgefüge
nicht herzustellen vermag. Es ist niemand da, der die zahllosen Flicken der
modernen Welt zu einem einzigen Teppich verknüpfen könnte. Je mehr Details der
Vergangenheit ans Licht kommen, desto unüberschaubarer, desto chaotischer wird
schlussendlich die Geschichte. Das ist der Ausgangspunkt von Cabrés
schwindelerregendem Roman:
Barcelona, Mitte des 20.
Jahrhunderts. Im Antiquitätenladen des Vaters entdeckt der junge Adrià Ardèvol i
Bosch eine Geige. Es ist eine der ersten Geigen, die der berühmte Geigenbauer
Lorenzo Storioni aus Cremona knapp 200 Jahre zuvor geschaffen hat. Als Adrià das
Instrument heimlich gegen seine eigene Geige austauscht, nimmt das Unheil seinen
Lauf. Die eigene Geige und sein Vater verschwinden. Wie sich später herausstellt
wurde der Sammler Fèlix Ardèvol i Guiteres ermordet.
Ein halbes Jahrhundert später rekonstruiert sein Sohn Adrià auf seinem
Sterbebett die Geschichte der Geige und die seiner eigenen Familie. Es ist eine
blutige, von Intrigen und Gräueln belastete Geschichte, die bis in das 14.
Jahrhundert zurückreicht. Das Sammlerstück aus Cremona wird zum Symbol einer
Geschichte des Verrats und der Gewalt, Symbol einer politisch abscheulichen
Geschichte, die auch einen langen Schatten auf Adriàs eigene Biographie a
capite usque ad calcem wirft.
Hauptort der Handlung ist das Barcelona der Nachkriegszeit, in dem Adrià mit der
Sammlung seines strengen, ja autoritären und von narzisstischen Elternwünschen
geprägten Vaters aufwächst. Sowohl Adriàs bester Freund, Bernat Plensa i Punsoda,
ein begnadeter Geigenspieler, der viel lieber Schriftsteller sein möchte, als
auch die fiktiven Ratgeber aus der Kindheit, Schwarzer Adler und Sheriff Carson,
begleiten Adrià ein Leben lang. Auf der Suche nach der wahren Identität seines
Vaters stößt er auf zahlreiche Familiengeschichten, die mit seiner eigenen auf
unheimliche Weise zusammenhängen.
Im Zentrum stehen die Leiden der Juden in Auschwitz. Ihr Blut klebt noch ein
halbes Jahrhundert später am Geigenkoffer. Noch älter ist das Blut, das floss
als Jachiam Mureda im 18. Jahrhundert das Holz für die Geige in den Wäldern von
Pardàc schlug, ehe Guillaume-François Vial seinen Onkel, den Komponisten
Jean-Marie Leclair tötet, um in den Besitz der Storioni zu kommen.
Vial, so heißt seither auch die Geige, die Adriàs Vater nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs einem SS-Mann unter Androhung, dessen Identität zu verraten,
für wenig Geld abkauft, wie Adrià während seiner Recherche erfährt. Und er
bringt ebenso in Erfahrung, dass die Geschichte der Storioni mit der Geschichte
der jüdischen Familie seiner großen Liebe Sara untrennbar verbunden ist: Ohne
das Sammlerstück wäre alles anders gekommen, wäre Adrià ein anderer geworden. Er
hätte Bernat, seinen besten Freund, der ihn am Ende verrät, nicht kennengelernt.
Und auch Sara, deren Tod ihn noch Jahre später unendlich schmerzt, wäre er nie
begegnet. Adriàs eigene Geschichte ist eine Geschichte der Schuld. Ihr Sinn
erschließt sich nur aus der Geschichte der Geige, dem ganzen Stolz seines
Vaters.
Jo confesso,
Ich gestehe, lautet der Titel des katalanischen Originals. Cabrés Roman ist in
der Tat ein langes Schuldbekenntnis seines Protagonisten Adrià Ardèvol i Bosch,
dem Gelehrten und Sammler. Die Geschichte dieser Geige ist die Geschichte der
Suche nach Vollständigkeit und Vollkommenheit in einer unheilbar unvollkommenen
Welt; einer Welt, in der es keine Gerechtigkeit gibt.
Cabré hat eine unglaublich fesselnde Geschichte verfasst; er sprengt ein ums
andere Mal die Grenzen des Romans und versetzt seine Leser durch die souveräne
Beherrschung einer sprachphilosophisch geschulten Poetik ins Staunen. Etwa dann,
wenn er Ramon Llull, Giambattista Vico und Isaiah Berlin, die großen
Ideenhistoriker, in einen faszinierenden Dialog treten lässt und nur andeutet,
welche Relevanz diese Denker auf die Idee des Romans selber haben.
Oder wenn der Chirurg in Auschwitz und SS-Obersturmführer Konrad Budden den
Augustiner und Mystiker des 15. Jahrhunderts Thomas von Kempen liest. Eine
Stelle, die exemplarisch für ein Universum philosophischer Anspielungen und
intertextueller Bezüge ist.
Cabré lässt historische und fiktive Personen in ein unendliches Gespräch über
den Sinn der Geschichte treten und schafft so neue, atemberaubende
Bedeutungszusammenhänge, die einen regelrecht erzittern lassen.
Seine Protagonisten finden sich plötzlich in einem anderen Jahrhundert wieder
und bringen auch dort ihre Überzeugungen ungeniert zum Ausdruck. Absoluter
Höhepunkt des Romans ist das Kapitel 24, in dem Cabré die Gräueltaten des
(historisch nachweisbaren) Großinquisitors Nicolau Eimeric aus dem 14.
Jahrhundert mit den bestialischen Methoden der SS, namentlich mit dem
Kommandanten des Vernichtungslagers Auschwitz Rudolf Höß, ineinander verwebt.
Wer kann noch darüber urteilen, ob die eine Gewalt die andere übertraf? Cabré
stellt sich auf die Seite der Opfer, für die es keine Rolle spielt, ob sie durch
die Inquisition ihr Leben und ihre Würde verlieren oder in den Gefängniszellen
von Auschwitz-Birkenau qualvoll zu Grunde gehen, nur weil es Barbaren gibt, die
das Elend der Anderen nichts angeht.
Es ist dieses so lange
verschwiegene Elend, das die Geige aus dem Antiquitätenladen von Fèlix Ardèvol i
Guiteres zum Ausdruck bringt. Die Geige, deren Klang so bezaubernd war, obwohl
immer nur die Toten ihr Lied spielten. Die Geige von Fèlix, dem Glücklichen,
dessen Geheimnis alles andere als Glück in die Welt des Adrià Ardèvol i Bosch
aus Barcelona gebracht hat.
|
Jaume Cabré
Das Schweigen des Sammlers Roman
Aus dem Katalanischen von Kirsten Brandt und Petra Zickmann
Suhrkamp
Gebunden
847 Seiten
24,95 Euro
978-3-458-17522-3
Leseprobe
|
 Glanz&Elend
Glanz&Elend