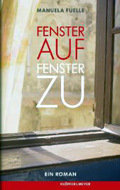|
Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
| Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |
Anfangs denkt man es geht um Walter, Elas Vater. Der Vater, der "Mutter und Vater in einem war". Der Vater und seine Schrullen. "Epikureisch" nennt ihn Ela, die Ich-Erzählerin. Das stimmt nur bedingt. Obwohl: Die Sparsamkeit geht scheinbar in skurril-kreativem Geiz über. Die Brötchen sind ihm zu teuer. Nach einem Gespräch mit dem Bäcker holt er für Kleingeld die "alten" Brötchen ab. Und steht ab sofort um 2 Uhr morgens dafür auf. Dumm ist er auch nicht. Er beschäftigt sich mit Spinoza oder Hegel. Hilfe kann er nicht aushalten; die Rückenschmerzen werden vertuscht. Aber es bleibt nicht bei den Anekdoten. 1968 ist Ela fünf Jahre alt, als sich die Eltern scheiden lassen. Sie und ihre Geschwister sollten sich entscheiden - für den Vater oder die Mutter. Jetzt und sofort. Dass die Eltern zusammenbleiben sollten - ihr Wunsch - war nicht vorgesehen. Sie, die Älteste, entschied sich für den Vater. Jahrzehnte später wohnt Ela in Tübingen und erhält mahnende Briefe von ihren Geschwistern: Der Vater sei verwirrt, bedürfe der Hilfe. Und weil sie, Ela, diesem Urteil über ihren Vater immer widersprochen habe, soll sie ihn suchen. Denn er ist spurlos verschwunden - weder in der Stadt noch auf seinem Hof im Großraum Berlin auffindbar; kein Lebenszeichen. Dabei hatten die Geschwister Probleme Ela telefonisch zu erreichen. Die ging nicht an den Apparat. Der Apfel, der nicht allzu weit vom Stamm fällt. Aber dann macht sie sich auf den Weg mit dem Zug, verpasst ihren Zielbahnhof, wird zu spät geweckt und geht die ganzen sieben Kilometer mit ihrem Rollkoffer zu Fuß zurück. Mehr als die Hälfte des Buches geht Ela auf der Bahnstrecke in die Dämmerung hinein und assoziiert dabei ihre Kindheit und Jugend in der DDR mit diesem Vater, Tante Helga (der ewigen Freundin), dem verwilderten Garten, den Haustieren bis hin zu Ziegen und all den anderen Ideen des manchmal arg müden Vaters, der im Beruf politisch neutral war, im Leben aber streitbar. Er war sogar ein Schulgegner und glaubte, die Kinder besser selber unterrichten zu können. Dennoch: Kein dezidiert falsches Leben. So heftig sind diese Erinnerungseruptionen Elas, dass manchmal vorletzte und letzte Worte eines Satzes verschluckt werden (man ergänzt das Fehlende problemlos). Am Ende immer mehr. Auch wenn es rückblickend nicht nur Idyllen sind - "glückliche Kinder" seien sie doch gewesen, so lautet Elas Resumé. Aber manchmal weiß man nicht, ob vielleicht die Erzählerin noch ein bisschen neurotischer als ihr Vater ist. Beispielsweise als sie im Jeepfahrer, der sie vom Bahnhof zum Hof bringt, plötzlich alle Anzeichen eines Massenmörders zu erkennen glaubt. Manuela Fuelle changiert zwischen kurzen, stakkatohaften und längeren, Thomas-Bernhard-ähnlichen eliptischen Sätzen. Ihr beschwörendes, mäanderndes, sich zuweilen Kausalketten verweigerndes Erzählen ist nicht immer nur luftig und die Lockerheit des Anfangs weicht irgendwann einer gewissen, zur (absichtsvollen) Redundanz neigenden Erinnerungs-Verbissenheit. Und doch überwiegt der Eindruck, etwas Schönes und vor allem Einzigartiges gelesen zu haben. Ein so ganz anderes Refugienbürgertum wie das der Familie Hoffmann aus Uwe Tellkamps "Turm". Ist es ein Fehler oder Absicht, dass der Vater 84 Jahre alt ist, aber zwischen 1929 und 1930 geboren ist? Phantasiert da eine Erzählerin in die Zukunft hinein? Wie auch immer: "Fenster auf, Fenster zu" ist ein elegischer, zärtlicher Abgesang auf eine Kindheit in der ehemaligen DDR, die mit dem Tod des Vaters droht, endgültig verloren zu gehen und noch einmal - fast rhapsodisch - evoziert und mit ruppiger Behutsamkeit vor dem endgültigen Vergessen gerettet wird. Das Schlussbild bleibt lange im Kopf. Ela steht vor dem mit einer Kette verschlossenen Tor vor dem "Hof" des Vaters - kein Zeichen, kein Licht, niemand ist da. Und dann beginnt es auch noch zu regnen und "alles Wasser fällt aus dem Himmel, und dann fällt der Himmel." Am Ende macht man sich wirklich Sorgen um den Vater. Und dann um die Tochter im fallenden Himmel. Gregor Keuschnig
Sie können diesen Beitrag
hier kommentieren:
Begleitschreiben |
Manuela Fuelle |
|
|
|
|||