|
Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 07.08.13 |
Über
David Marksons Roman
»Wittgensteins Mätresse« und
Von
Peter V. Brinkemper |
||
|
David Marksons Roman »Wittgensteins Mätresse«, 1988 publiziert bei Dalkey Archive Press, Illinois, ist im Berlin Verlag erschienen (2013), in der ziemlich schlagfertigen Übertragung von Sissi Tax. Und die muss es auch sein, wenn sich literarische Ansprüche mit Wittgensteins Diktion zwischen Analyse, Rätsel und Sentenz in einem Roman wie in einem letzten Außenposten zwischen Land und Meer überkreuzen. Das Werk wird ergänzt durch programmatisch erläuternde Texte von Elfriede Jelinek und David Foster Wallace. Der New Yorker Autor und Dozent David Markson (1927-2010) operiert in diesem wahrhaft anti-kulinarischen Roman auf der Grenze zwischen Literatur, Malerei und Philosophie. Für Insider steht Markson an der Speerspitze der postmodernen Literatur der 1980er Jahre. Wieviel Wittgenstein steckt in diesem Roman? Und wie romanhaft oder literarisch ist das zitatengesättigte Werk in seiner philosophischen oder auch poetischen Struktur? Das doppelte Erbe Wittgensteins Keine zukünftige Philosophie führt an Ludwig Wittgenstein vorbei. Aber muss dieser Satz auch für die Literatur gelten? David Foster Wallace ist davon fest überzeugt, und deshalb ist für ihn Marksons Buch, nicht nur wegen der im Titel genannten Programmatik, ein Meilenstein moderner Literatur. Gemeint ist vor allem der Denkweg, der mit dem »Tractatus logico-philosophicus« in Wien 1918 seinen Anfang nahm und in den »Philosophischen Untersuchungen«, ab 1937 in Cambridge entstanden und posthum veröffentlicht, eine ausgereiftere Gestalt gewann. Was im »Tractatus« äußerlich als konsequenter, einheitlicher Entwurf eines früh vollendeten Autors erscheint, nimmt sich in Wittgensteins »Untersuchungen« wie eine Zerfransung und Verzettelung in zahllose Einzelbetrachtungen aus, wie ein Fächer von Oberflächen- und Tiefenanalysen, die dennoch allesamt um ein kohärentes Thema kreisen. In den »Philosophischen Untersuchungen« macht sich Wittgenstein auf eine nüchterne und mühselige Suche. Die Alltagssprache wird auf den Prüfstand gehoben. Die Verstehbarkeit und Funktionalität normaler Äußerungen ganz gewöhnlicher Sprecher soll erläutert und erklärt werden, allerdings möglichst vorurteilsfrei und ohne irreführende Sprach- und Denknormen aus Logik, Wissenschaft und Philosophie. Kein leichtes Unterfangen, damals am Beginn der analystischen Sprachphilosophie wie im Dekonstruktivismus der 80er Jahre, und auch heute noch ein gedankliches Abenteuer. Im »Tractatus« betrachtete Wittgenstein Sprache noch als Mittel und formalisierbares Objekt einer positivistischen und formalen Logik, die drakonisch darüber entschied, was überhaupt noch gedacht und gesagt werden konnte. Rund 20 Jahre später wendet sich Wittgenstein in den »Untersuchungen« einem weitaus komplexeren Verständnis von Sprache und Denken zu. Er misst der alltäglichen Sprache eine Dimension eigener Erfahrung, Erkenntnis und Handlung zu – durchaus im Sinne von Humes erkenntnistheoretischem Skeptizismus und seiner Annahme, dass empirische Ereignisse, auch nach hoher Konstanz im beobachteten Ablauf zahlreicher ähnlicher Fälle grundsätzlich unvorhersehbar bleiben. Mit Hume sind selbst Kulturinstitutionen wie die menschliche Sprache und Verständigung keine rein logischen, luziden Kristalle, keine mechanischen Techniken, sondern dichte, von Dunkelheiten durchzogene Medien, deren Bedeutungen sich nur partiell und bei Gelegenheit immer wieder neu aktualisieren und explizieren lassen – im gemeinsamen oder strittigen Gebrauch der Wörter, Sätze und Äußerungen durch die aktiven Sprachteilnehmer. Niemand, so der spätere Wittgenstein sinngemäß, könne allein sprechen oder allein einer Regel folgen; jede Regel habe ihre Unschärfen, werde aber von Situation zu Situation, als Praxis der Teilnehmer immer weiter expliziert. Die Intersubjektivität der Kommunikation ist für Wittgenstein vor allem als alltagsverflochtenes Sprachspiel einer Pluralität von Kommunizierenden zu verstehen, keinesfalls als alltagsentbundene Abstraktion. Dabei tritt der Denker weit aus dem Raum des vorschnellen Verstandenhabens weit heraus, um den verfremdenden Blick auf die vermeintlichen »Selbstverständlichkeiten« von Sprache, Sprechen und Verständigung zu richten. Die Mixtur der »Untersuchungen«, zwischen behutsamem logischen Fortschritt und geradezu romanhafter Verfransung im Detail, analytischem Feinsinn und überraschend aphoristischer Zuspitzung, steht im scharfen Kontrast zur scheinbaren Geschlossenheit und idealen Konstruiertheit des »Tractatus logico-philosophicus«. Dieser formulierte die Regeln eines positivistisch verwissenschaftlichten Sprach-Gerüsts, das als Instrument die Tatsächlichkeit unserer Welt exakt und selbstgenügsam im Rahmen des angeblich Sagbaren abbildete und jegliche metaphysische Dimension, auch die Möglichkeit eines weitergehenden reflexiven Denkens, apodiktisch ausschloss. Der »Tractatus« war eine Kampfansage, der jugendlich-leichtsinnige Imperativ einer Kulturrevolution, sofort gegen jegliche Form der spekulativen Behauptung anzukämpfen, um sie der Ungültigkeit und Bedeutungsleere zu überführen. In Wahrheit ist der »Tractatus« jedoch keine monolithische Mao-Bibel für neuste Positivisten, sondern eine Mischung verschiedener Textsorten: Eingebaut in die berühmte, bauhausförmige Dezimalgliederung sind neben eigenständigen Gedanken und bekannten, längst ausgewrungenen Sentenzen auch schulförmige Axiome und logische Schlussformen. Hinzu treten, von vielen unbemerkt, merkwürdig narzisstische Jugendstilpassagen und Reminiszenzen der traditionellen Kultur: »Wie im Märchen die zwei Jünglinge, ihre zwei Pferde und ihre Lilien. Sie sind alle in gewissem Sinne Eins.« (4.014) Ausgerechnet mit diesem Art-Deco einer Spiegelung will der frühe Wittgenstein in Wien um 1918 die nachsachlich-coole, metaphysikfreie interne Abbildtheorie zwischen Sprache und Welt illustrieren, am Beispiel von musikalischem Gedanken, Notenschrift, Schallwellen und Grammaphon-Aufzeichnung, und gerät immer tiefer in den Mythos einer selbstreferentiellen Konvergenz. David Markson: Konstruktion von Ich und Welt
»Es gibt keine Malutensilien
in diesem Haus. Es ist wie verhext, die der Erzählerin eigentlich zu Gebote stehenden Ausdrucksmittel der Malerei sind in und aus der Wirklichkeit verschwunden. Und ausgerechnet ein in einen anderen Raum transportiertes Gemälde, ein Werk der Kunst und womöglich der Mutter also, soll darüber Auskunft geben. In David Marksons Roman »Wittgensteins Mätresse« artikuliert sich ein weibliches Ich, eine Malerin, die in einem leeren Ferienhaus am Strand kaum Ablenkung findet und doch ständig durch ihre eigenen Eindrücke und Einfälle abgelenkt ist. Nur widerwillig wechselt sie vom Medium der Malerei zur Literatur und tippt auf der Schreibmaschine, um zunächst recht wenig von sich preiszugeben. Sie notiert das Drama des begabten Kindes, die überforderte, wenn nicht gar leere Konstruktion eines personalen Zentrums, Randexistenz in einer verlorenen Welt und zerbrochenen Sprache. Und doch, wenn es darauf ankommt, auch seismographisch, kraftvoll, zwischen schwarzem Humor, Trauer, Rücksichtslosigkeit, Verachtung, Exhibitionismus und letzter verzweifelter Anmaßung. »Kate«, so wird sie, in ihrer eigenen Erinnerung, anfänglich von ihrer verstorbenen Mutter gerufen; gegen Ende wird die erinnerte Mutter sie »Helen« nennen und in ihrem Selbstverständnis, eine Künstlerin zu sein, zurechtweisen. Und sie ist vielleicht die im Titel avisierte imaginäre Mätresse Wittgensteins. Oder auch nicht. Aus Angst und Depression geboren zur unfreiwilligen Denkerin, die ersehnte, aber auch die versteckte Frau, fast eingeschlossen hinter den Kulissen offizieller Erziehungs- und Ordnungssysteme. Sie breitet sich vor dem Leser aus, nicht in einem kontinuierlichen Text, sondern im massiven Patchwork knapper künstlerischer und allgemeiner geschichtlicher Anspielungen, logischer Bezüge, absurder Spielzüge und imaginärer Begegnungen. Keine szenisch ausgearbeiteten Kapitel eines Romans sondern lauter schief angebrachte Bilder und Momentaufnahmen, zum Teil fast austauschbar, in einem einzigen chaotischen Ausstellungsband, unordentlich miteinander verbunden, Ansichten und Perspektiven, in ihrer Versprachlichung eigentümlich autistisch, subjektiv, defekt wirkend, aber auch unerwartet logisch zugespitzt, immer wieder im narrativen Fortgang stockend, verzögernd, ausweichend und sprunghaft. Viele der dabei verwendeten Satz- und Aussagenmuster klingen wie fragmentierte Echos aus dem »Tractatus«, voll von Konfusionen und Widersprüchen, wie sie der frühe Wittgenstein radikal ausfiltern oder übertünchen wollte. Sogar der Nouveau Roman kennt das Gerüst einer Quasi-Handlung. Marksons Werk liegt ein sorgsam gehüteter Plot zugrunde, eine schwierige Beziehung zu den verstorbenen Eltern, zu rigiden Mutter, unglückliche Beziehungen zu Männern, einem Ehemann, Adam, zu Liebhabern und zu einem oder zwei Söhnen. Es kommt zu Verwechslungen, bis sich ein oder zwei Namen für frühverstorbene Kinder herausschälen: Simon und Lucien, bei letzterem vielleicht ein qualvoller Tod durch Meningitis. Die fragmentierten Spuren des Erzählens weichen an vielen Stellen den Lebenstatsachen wie hochempfindlichen Sprengminen aus. Rätselhafte Zufälle, Unfälle, tödliche Krankheiten, Katastrophen, Pyro- und andere Manien, Alleinsein, Umherschweifen und Weltverlust. All dies läuft auf die Abschaffung des gewöhnlichen Realismus und auf die Maximierung des semantischen Spielmaterials bis an der Grenze zur Verzweiflung hinaus. Was am Anfang wie ein paradox ausuferndes Präludieren im »Tractatus«-Stil mit vielen amüsanten Noten und Nebennoten anmutet, wird in der Folge zur Hölle endloser Wiederholungen und tückischer Variationen, mit Einblicken in schmerzliche Untiefen, die den vermeintlichen oder tatsächlichen Unrichtigkeiten erst ihr volles emotionales Relief geben. Zertrümmerung im Ein-Satz-Stil und wilde malerische Abstraktion Kennzeichnend für die elementare Äußerungsweise des Romans sind die Ein-Satz-Behauptungen wie in Wittgensteins »Tractatus«. Sein berühmt-berüchtigter Eingangsatz »Die Welt ist alles, was der Fall ist« wird von der Erzählerin irgendwann unvermittelt zitiert und kontrapunktiert vom Stichwort der »bricolage«:
»Die Welt ist alles, was der
Fall ist. Die kulturelle Person Ludwig Wittgenstein wird erst später in den Text eingeführt. Marksons stilistische Leistung liegt darin, die realitätsbezogene und die rein immanent-fiktive Funktion der Behauptungen durch ständige performative und inhaltliche Widersprüche und Zurücknahmen in metonymischer Bewegung zu halten. So entsteht ein sehr illusionsloses, tastendes und taktierendes Erzählen zwischen Konzentration und Ablenkung, Abwehr und Öffnung. Und man weiß nie, in welcher Funktion die Äußerungen und Aussagen soeben getroffen werden oder getroffen worden sind, ob ihre Geltung noch in Kraft ist oder längst widerrufen wurde. So wiederholt die Erzählerin das Gegenwort »bricolage«, beim Strandspaziergang und auf der Muschelsuche, »hunderte Male«, allerdings nicht in Form einer eindeutigen Namens-und-Objekt-Taufe sondern im Sinne des endlosen Sich-selbst-Vorsagens. Markson gelingt es im Stil der kommentierenden Anmerkungen aus den »Philosophischen Untersuchungen«, nur ungleich beiläufiger und geschmeidiger, Äußerungen und ihre Inhalte zu zerdehnen, zu zergliedern und zu verfremden – in unendlichen Fußnoten, nicht enden wollenden Marginalien, Randbemerkungen ohne Rand, voller mikrologischer narrativer Fortschritte und Rückschritte, Relativierungen, Dementi und Einschränkungen, bis dem Leser Lachen und die Übersicht vergangen sind. Die analytische Performanz der Wittgensteinschen Diktion wird zur Unerträglichkeit parodiert, ihre logische Sezierkraft im Leerlauf oder in aufschlussreichen Situationsanalysen auf Hochtouren gehalten. Im Wellengang des Über-Redens und Über-Schreibens geht die Sprache in virtuelle Kritzelei (Cy Twombly) und wilde Wort-Malerei über. Äußerungen verdichten sich und löschen sich aus. Viele der Aussagen und Aussageformen Kates sind an den Diskurs der bildenden Kunst angelehnt. Erzählerische Ansätze (Handlungen, Figurenentwicklung oder psychologische Vertiefung) entfalten sich nicht bis zur Ausführlichkeit einer ausgereiften Darstellung und Darlegung, sie gerinnen in verknappten, kurzschlüssigen Bildern und Bezügen. Reale, imaginäre, photographische oder gemalte Ansichten und Postkarten (vgl. den sich überschlagenden »VW-Bus voller Ansichtskarten«) stehen nebeneinander; alltägliche und künstlerische Perspektiven durchdringen sich einander oder stellen sich wieder infrage. Die typischen Einheiten und Abschnitte sind relativ kurz, listen- und katalogförmig, an der Oberfläche scheinbar nivellierend gehalten. Hier liegt der blinde Fleck von Kates Kognition und Recognition, ihr offensichtlicher Mangel an Differenzierung. Wittgenstein schreibt in seinen »Philosophischen Untersuchungen« (§ 389): »>>Die Vorstellung muss ihrem Gegenstand ähnlicher sein als jedes Bild: Denn wie ähnlich ich auch das Bild dem mache, was es darstellen soll, es kann immer noch das Bild von etwas anderem sein. Aber die Vorstellung hat es in sich, dass sie die Vorstellung von diesem, und von nichts anderem, ist<<. Man könnte so dahin kommen, die Vorstellung als ein Über-Bildnis anzusehen.« Bei Kate sind eigene Vorstellungen und vorgegebene Bilder, anzueignende Geschichte und zufällige Aufzeichnungen, Artefakte oder Quellen auf trügerische Weise eins. Sie ist einem malerischen Bild- und Objektwahn erlegen. Und ihm opfert sie auch die exakte Wahrnehmung und unterläuft die Apperzeptionsformen des selbstständigen und konsistenten Denkens im Raum und Zeit. Damit ist das postmoderne Verwirrspiel, zwischen Sprache, Titel, Bild und metaphorischem Bedeutungs- und Denkspielraum, vorprogrammiert. Niemand kann nur seine eigene Ausstellung oder sein eigener Katalog sein. Wer sich so verhält, verleugnet die Autorenschaft und flüchtet sich in die Ersatzrolle der Mätresse. Kate funktioniert beim Schreiben nicht nur im Sinne einer amoralischen Postmodernität, sie handelt im Schreiben auch als seelisch beschädigte Person, reagiert auf Traumata, Depression und Angstzustände (siehe die zahlreichen Kierkegaard- und Heidegger-Anspielungen). Im Subtext wird das Phänomen der »Mätresse« immer wieder thematisiert: Künstlerin, Geliebte und Prostituierte, Herrin im Nahbereich, die Rolle der Frau oder des Subjekts, als ab- und anwesender Gestalt, mitten in einer fremden (männlichen) Ordnung, oder als Gefangene in einem anderen, eigenen und engen System. Ein Homosexueller, wie Wittgenstein es »doch« gewesen sei, heißt es gegen Ende, könne »nie« eine Mätresse gehabt haben. Jede Gender-Reflexion und anspruchsvolle Literaturtheorie wird über diesen simplen Biographismus schmunzeln. Mätresse zu sein ist keine Frage des Geschlechts sondern der sozialen Diskriminierung oder Abschottung und Doppelmoral. Zahllose mythische Lebensläufe und verbürgte Künstlerinnen-Biographien treten nebeneinander auf: Helena, Klytämnestra, Penelope, Briseis, Kassandra, Jeanne Héburterne (Modigliani), Suzanne Valadon (Utrillos Mutter) und die Moulin-Rouge-Tänzerin Jane Avil. Hierhin gehören auch männliche Absonderlichkeiten, so die polysexuellen Verwandlungen des Achill oder die viktorianischen Torheiten des Malers und Kunsthistorikers und Turner-Freundes John Ruskin, der über den Unterschied seiner lebendigen Braut und einer antiken Marmorstatue in aller Unschuld schockiert gewesen sein soll. Kate macht sich die Welt gefügig, indem sie sich in sie einzufügen versucht, aber sie hat keine Welt außerhalb ihrer verglühenden Puppenstube. Sie bezieht ihre Identität aus dem Überall von Geschichte, Kartographie und Kultur, aber sie bleibt sich selbst unbekannt. Sie hängt später ihre eigene malerische Produktion, so schreibt sie, in die Zwischenräume und Lücken einer Ausstellung im Metropolitan Museum of Art, aber dabei handelt sich um eine »Mise en abyme «. Kate verdünnt ihre Repräsentationen zur unendlichen Rekursivität. Sie signiert eigene und fremde Spiegelungen auf Spiegeln, die am Ende für sie selbst nichts mehr wiedergeben. Doch wo lauter Kates und lauter Katzen, Cats, sind, wer schaut dann wo genau hin? Und wer befreit und wer blockiert wen? Nur anfänglich habe sie ihre Präsenz in den Museen der Welt in der Form »Jemand lebt im Louvre/in der National Gallery/im Louvre« als Botschaften auf die Straße geweißelt. Und diese Straßensignaturen entsprechen der Ankündigung: »Jemand lebt an diesem Strand.« Zu Beginn der Aufzeichnungen werden Vorstellungen, die mit der beklemmenden familiären Erinnerung an das Ferienhaus am Meer zusammenhängen, auf eine während des Schreibprozesses zunächst nicht veränderliche Gemäldeansicht, die jemand anderes schuf, projiziert. Malen als ein Medium, sich selbst seit der Kindheit als Fremde betrachten zu müssen. Malerische Produktivität und Familien-Erinnerung, sind dem eigenen Zugriff verschlossen. Daher die überwältigende Altklugheit der Kulturzitate. Und der Text, der nun entsteht, als Ringen um einen solchen eigenen Zugriff. Gelegentlich verfällt Markson dem ungezügelten akademischen Spieltrieb eines kompetenten Literatur-Dozenten. In unaufhaltsamer Brachialität entwickelt er repetitive industrielle Muster, oft mit parodistischem Unterton (Schostakowitsch: »Panzer vom Fließband«). Der intellektuelle Leser, der einfühlsame Rezipient und der Krimi-Konsument sind die Adressaten dieses Buches: Wer die Lektüre anti-belletristisch für sich anhält, unterbricht und sich die Mühe macht, Stichworte und Quellen anderswo nachzuschlagen und Varianten und Kombinationen zu sondieren, hält dem strukturellen Dauerfeuer von Marksons Text inhaltlich stand. So lichtet sich das Labyrinth der Lektüre von Mal zu Mal, und zwar mit Gewinn. Hinter dem verwickelten Gedankenverlauf stecken stimmige Angaben zur Kunst, ein gehöriges Quantum Klatsch und Tratsch und eine abgerundete Psychologie der Hauptperson. Name-Dripping und Polysemie Der Titel »Wittgensteins Mätresse« könnte als surrealer Zufall, absolute Synekdoche, Karambolage der Wörter und Bedeutungseinheiten verstanden werden. Diese ergibt sich aus dem Name-Dropping- oder Name-Dripping-Verfahren (Pollock). Das Tropfen der Namen und das Zerlaufen der mit ihnen verbundenen Inhalte zu allseitigen Spuren führt zur globalen Synonymie und Polysemie: zum Anspielungsreichtum von Kunst, Literatur, Musik, Film auf der Basis der Mythologie (Ilias, Odyssee, die Tantaliden, der Pelide Achill, der anfänglich wie ein Mädchen eingekleidet wurde, um den Kriegseinsätzen und seinem geweissagten Tod vergeblich zu entkommen). Die transatlantische Geographie multipliziert die europäischen und die amerikanischen Namen, schafft zahllose imaginäre Doubletten, und läuft in bestimmten textuellen Flächen auch gewaltig leer, wie bei einem Ausstellungskater mitten im nicht enden wollenden Louvre-Besuch. Kate verbrennt das Mobiliar von Strandhäusern an der US-Ostküste des Atlantiks, wie griechische und trojanische Leuchtfeuer, um ihre traumatische Erinnerung zu überwinden. Auf den Inseln der Ägäis rücken antike und moderne Sagengestalten zusammen, auf Achills legendärer Fluchtinsel Skyros liegt auch das Grabmahl des jung verstorbenen Poeten und britischen Gallipoli-Kämpfers Rupert Brookes. Strand und Meer sind Metaphern des Verlustes der eigenen Lebenswelt und der Flüchtigkeit des Schreibens. Angeblich nistet sie sich in weltberühmten Museen ein, verbarrikadiert sich dort als Okkupantin, kommt berühmten Bildern, Motiven und Malern auf obsessive Weise nahe, ohne die Ordnung von Wissenschaft, Ökonomie und Tourismus, ohne feste Ausstellungszeiten, als Kunstjunkie mit eigener Performance im aufgebrochenen Kulturtresor. Bilderrahmen werden bei Bedarf verfeuert, die abgezogenen Leinwände der Werke wieder auf die Wand genagelt. Bekannte und weniger bekannte Namen werden im doppelten Prozess der Bedeutungsanmaßung und der inflationären Entwertung unterzogen. Mit der schwindenden Präsenz und Kontextlosigkeit von Kunst und Künstlern nimmt der Roman die digitale Repräsentanz der kulturellen Objekte im heutigen Netz vorweg. Dem Anschein intensiver Vergegenwärtigung stehen die angedeutete materielle Zerstörung und Verstörung im Bewusstsein der Erzählinstanz entgegen. Verwechselungen, Vertauschungen und Korrekturen der Eindrücke unterbrechen die narrative Logik. Die Objektivität der Restwelt ist abhanden gekommen, sie ist weder konsequent vorgegeben, noch wird sie vom verwirrten Subjekt geleistet. Der Ausverkauf der Kultur trifft auf Katalog- und Ausstellungspanik, Arte Povera und Art Brut. Immer häufiger runzelt der Leser die Stirn und traut den Einzelangaben zu biographischen und kulturellen Details nicht mehr über den Weg. Doch wer erneut und anderweitig nachschlägt, entdeckt, dass die kulturellen Bezüge und weitgespannten Angaben auf der Ebene isolierter Tatsachen meist haargenau stimmen. Und zwar ausgerechnet dort, wo der Text in seinen syntaktischen Inszenierungen, Sprüngen und schiefen Assoziationen noch unwahrhaftiger, unglaubwürdiger und »kunstseidener« klingt. Unter der Oberfläche des Textes verbirgt sich ein knöcheltiefer Kulturteppich. Wittgenstein soll es wirklich während seines Aufenthaltes an der Galway Bay in Irland gelungen sein, eine bestimmte Möwe zu zähmen und zu füttern. Soviel Sinn für Natur, Individualismus und Beziehung muss auch bei einem distanzierten Analytiker sein. Zu den beabsichtigten Webfehlern gehören Namens-Konglomerate wie Jacques Lévi-Strauss und Jacques Barthes (Lacan und Derrida lassen grüßen), Komposita, die meist amerikanischen Sportlern oder den Filmschauspieler/Rollen-Paaren »Clara (Schumann/Katharine) Hepburn« vorbehalten sind. Die Rekord-Baseballspieler Babe Ruth und Lou Gehrig aus der Epoche des echten Stadionrasens (1920er bis 40er Jahre) starben an Krebs und Amyotropher Lateralsklerose. Sie erscheinen wie Märtyrer, die Kates privates Familienleiden vorwegnehmen. Voller Melancholie wird gewettet, dass Anna Achmatowa, die stalinistisch unterdrückte große russische Schriftstellerin die »einzige Person in Anna Karenina« sein könnte. Markson führt gnadenlos durch ein bildungscrashendes Underground-Seminar, um William Gaddis’ liebevoll realistisch auserzählendes Raffinement in »The Recognitions« (»Die Fälschung der Welt«), öfters erwähnt, jokulatorisch Paroli zu bieten. Graffiti-förmige Kurz-Anspielungen auf dem Gebiet der Malerei werden nicht nur Kenner verblüffen. Pinturicchio wird mit seinem Gemälde »Penelope und ihre Freier« (1509) in den Themenstrang antike Mythologie eingebaut. Penelopes Webstuhl ist der transzendentale Rahmen für die Konstruktion einer Welt des jahrelangen Wartens und der Abwehr der in den Raum eindringenden männlichen Freier. Oder sollte sie ihnen doch nicht widerstanden haben? Der Webstuhl korrespondiert mit dem Fenster im Hintergrund, das der maritimen Welt zugewandt ist und den Blick auf zentrale Stationen der Irrfahrten von Odysseus (so den Gesang der Sirenen) freigibt und die innere Odyssee der Erzählerin zu kommentieren scheint.
»Es gibt wirklich ein Gemälde
von Penelope, beim Weben in der National Gallery, von jemandem namens
Pintoricchio. Die Hilflosigkeit der Erzählerin bei der Bildbeschreibung hat eine ganz andere Funktion. Sie bereitet die Konvergenz zwischen der autobiographischen Unterdrückung und der späteren musealen Fixierung vor: Noch schlägt die National Gallery die Insel Ithaka. Und die Applikation der Figur Penelopes auf die Erzählerin geht freilich so glatt nicht auf. Denn neben dem gemalten Webstuhl und zu Füßen Penelopes, ist eine jüngere Dienerin an einer Spindel, meditativ wie Dornröschen, und damit eine ungleich passendere Stellvertreterfigur der Erzählerin, sowie eine graue Katze, zu entdecken. Diese allein, und ausgerechnet nicht die junge Frau, wird wenig später im Text ausdrücklich durch die Erzählerin erwähnt. Diese Katze liegt eingerollt am Boden, in einem theatralischen Aside oder einem filmischen Off. Was der Text nicht erzählt: Sie spielt mit einem Wollknäuel, sie hält es sogar fest und ist damit eine spielerische Antipode zur Arbeit der jungen Dienerin oder jungen Frau bei der Herstellung eines brauchbaren Webfadens. Währenddessen dringen auf der Höhe von Penelopes Figur und ihrem Webstuhl Freier in den Raum (und vielleicht erscheint in der Tür ein Bettler, hinter dessen Verkleidung sich der rächende Odysseus verbirgt). Für Kate sind Leinwand und Rahmen die pathologischen Bestandteile einer von der Mutter dominierten Kunst. Und die Katze ist für sie ein stummes, die Gattung repräsentierendes Leitmotiv, eine apotropäische Gegenfigur und ein Gegenbild zu einer eigenen, lange ausbleibenden begrifflichen und existenziellen Identität, im Kontrast zu den mit ihrer eigenen Hysterie und Verunsicherung verbundenen Schwarmvorstellungen, nicht nur der Möwenansammlungen in Südconnecticut und dem Long Island Sund, ein kreatürlich-beharrliches Alter Ego, eine mythische Gestalt wie im Colosseum, ein fast außerweltliches Ding an sich, das den Text der gesamten Aufzeichnungen geduldig als Träger und Projektionsfläche unterschiedlicher Namen von Namensgebern aus allen Zeiten durchzieht: Wahn und völlig vernünftige Sehnsucht in einem.
»Wie ich diese Katze jetzt
nenne, ist Magritte. T. H. Lawrence von Arabien, einem Altersgenossen Wittgensteins, wird zur Signatur einer weiteren imperialen und filmischen Clownerie um verdeckte Identitäten, die die Langeweile der musealisierten Kultur durch die Lust am Abenteuer, Krieg und Tod im Dienste der martialischen Expansion aufwertet. Unter dem Pseudonym T.E. Shaw hatte Lawrence wohl in der Tat Homer übersetzt, wie so viele gebildete Männer seiner Zeit. Troja und seine Eroberung als modisches Dauerthema auf höchstem Niveau. Bildung oder Agententum als Top-Secret-Aktion verquerer Identitätsbildung? Johannes Brahms, von dem die Erzählerin eine mittelmäßige, in der Seeluft aufgequollene Biographie, wie manch anderes Buch, seitenweise nach der Lektüre verbrennt, um mit dem aufflammenden Billigpapier den Segelflug der Möwen nachzuahmen, fand in Wien seine Vollendung als Sinfoniker und Kammermusiker. Als legitimer Nachfolger Beethovens trat er noch leibhaftig im Musiksalon des Palais Wittgenstein zu Ludwigs Kindertagen auf und konnte womöglich dem späteren Philosophen seine notorischen Bonbons zustecken. Nicht nur Helen Frankenthalers Name, auch andere ihrer Künstlerkollegen wie Willem de Kooning (oder seinem Pop-Art-»Eraser« Robert Raschenberg), stehen für den Wettstreit von Marksons reichlich Material aufbietender und vernichtender Erzählweise mit den Vertretern des New-Yorker Abstrakten Expressionismus. Irgendwann sitzt die Erzählerin nur zehn Fahrminuten entfernt von der Künstlerkolonie Springs auf Long Island, dort, wo Jackson Pollock, soeben definitiv zu Ruhm gekommen, in seinem Oldsmobile mit einem Baum tödlich kollidierte.
David Foster Wallace: David Foster Wallace lobt in seinem Essay David Marksons Roman als gelungenes Vabanque-Spiel zwischen genuiner Poesie, intellektueller Ausrichtung und unterhaltsam tragikomischer Lesbarkeit. »Der Roman macht Wittgensteins frühes Werk lebendig, schenkt ihm ein Antlitz, das der Leser behalten wird, etwas, das die Philosophie nicht leistet & auch nicht leisten kann«. »Seine Mätresse jedoch stellt die Frage, die ihr Herr und Geliebter auf dem Papier nicht stellt: Was wäre, wenn irgendwer wirklich in einer Tractatusisierten Welt leben müsste?« Und Wallace lässt keinen Zweifel, dass Marksons Roman diese Frage nicht akademisch, sondern lebendig literarisch beantwortet und in einer »unmittelbaren Studie von Depression & Einsamkeit« schildert. All dies könnte man für eine gut begründete Werbung halten, wenn Wallace nicht seiner speziellen Vorliebe zum philosophischen Bekenntnis frönte und dem frühen Wittgenstein ausschließlich die Tendenz zum Solipsismus unterstellte. Wallace betont immer wieder: Alles läuft auf Solipsismus hinaus. Und damit meint er die modernste Autarkie einer Kopf-Kunst, die sich von der Realität wenigstens negativ distanziert und befreit und das Subjekt, ob es nun diese Kunst will oder nicht will, ständig mit dem Risiko des Wahnsinns konfrontiert. Im »Tractatus« heißt es gegen Ende ganz genau (5.64): »Hier sieht man, dass der Solipsismus, streng durchgeführt, mit dem reinen Realismus zusammenfällt.« Bei Wittgenstein sind Solipsismus und Realismus also ein Paar. Wie geht das zusammen? Wittgenstein behauptet hier die aus seiner Sicht die einzig mögliche Realität eines philosophischen Ichs: Das philosophische Ich könne nur als Grenze der empirischen Welt existieren, ohne selbst eine greifbare empirische Realität zu sein. Schon der frühe Wittgenstein führt also nicht weniger als einen minimalistischen Realitätsbeweis für die Existenz des philosophischen Ichs, wenigstens als Randung der empirisch erkennbaren Welt, ohne hier jedoch diesem Umstand eine weitergehende positive erkenntnistheoretische oder ethisch-metaphysische Bedeutung beizumessen. Wallace stellt dagegen eine zeitgemäße, aber etwas verquere Autoren-Solipsismus-Doppel-These auf, mit sinngemäß folgendem Schema: 1. Denken: Der eigene Kopf ist oder enthält die ganze Welt. Man existiert nur im Denken. Man verbringt denkend und schreibend/schreiben-wollend in dieser Kopfwelt seine Zeit, in einem Gefängnis und zugleich mit Inhalt anstauenden Geburtskanal, um die Welt in sprachlicher Gestaltung irgendwann, zunächst für sich allein, auf Papier zu bringen. Das Papier ist erst einmal der rein geistige Ort dieser Kopfwelt. 2. Existenz: Ich existiere als ein reales Ich und die Welt existiert als eine bestimmte reale Welt (und ich existiere in dieser realen Welt). In dieser Korrespondenz und diesem Kontext wird das Schreiben zu einem realen Akt der Kommunikation mit der Kette zwischen Freiwilligkeit, Impuls, Gelingen/Scheitern, Autorisieren, Publizieren und Gelesen-Werden und der möglichen Anerkennung. Doch in welcher Relation stehen denkendes und reales Ich beim Schreiben? Wallace hält beide Entitäten in der Theorie strikt auseinander. Aber er scheut nicht davor zurück, in Bezug auf die Person Wittgensteins und Marksons Darstellungsleistung naturalistische Fehlschlüsse zwischen beiden Ebenen zu begehen, und z. B. Kate und Wittgenstein in trivialer Form gleichzusetzen: »damit meine ich, wie erschöpfend WM (»Wittgensteins Mätresse«) aufzeigt, weshalb einer der cleversten & wichtigsten Denker, die Bausteine zum modernen Denken lieferten, zu einem in seinem Privatleben derart kreuz-unglücklichen Kerl werden konnte«. Muss sich Ludwig denn privat genau wie Kate gefühlt haben, oder sollte Kate umgekehrt Philosophie studieren und einen »Tractatus« schreiben? In einem zweiten, rein theoretischen Schritt setzt Wallace seine beiden Ebenen in Parallelität mit den beiden Polen des Cartesischen »Cogito, ergo sum«. In Descartes’ »Meditationen« wird das Denken, genauer das »Ich denke« (Cogito), als eine zweifelsfreie, selbstgewisse Tatsache des Geistes gedacht. Und aus ihr wird zugleich die Existenz (Ich bin = sum) des Ich (je nachdem, wie eng ich den Beweis führe, als rein geistiges oder auch als faktisch-reales Ich) abgeleitet. Daher sind die beiden Pole »Denken« und »Existieren« miteinander verbunden. Wallace hingegen trennt mit Berufung auf Wittgenstein sogar im Falle von Descartes’ Argumentation das »Cogito« von der (empirischen) »Existenz«. »Die Wahrheit des >>ich denke<< ergibt lediglich die Existenz des Denkens, genau wie die Wahrheit des >>ich schreibe<< lediglich die Existenz eines Texts abwirft.« Über ein faktisches Ich, das hinter dem Denken und Schreiben stehe, und über sein Verhältnis zum Denken und Schreiben, oder gar zu einer faktisch-realen Welt, sei damit noch nichts gesagt. Im Sinne des logischen Atomismus von Russell und Wittgenstein seien die Einzel-Fakten der Welt (und ihre korrespondierenden Basissätze) vielleicht gar keine Außen-Phänomene und keine Eigen-Existenzen sondern bereits lediglich anschaulich-denkerische Gegenstände des »Kopfes«, zwischen positiver (Re-) Konstruktion, aber auch »Skeptizismus«, »Solipsismus« und sogar »Wahnsinn«, also Teil von Haltungen und Bewusstseinszuständen, die auch literarisch wertvoll seien. Nach Wallace benutzt Markson mit Wittgensteins »Tractatus« ein Modell, die Welt aus der Perspektive von Kates angeblich modernem weiblichen Bewusstsein als de-realisiertes, umgepflügtes Feld darzustellen, als ein Arsenal von teils benannten, teils namenlosen Personen, Gegenständen, Daten und Bildern, über deren Zusammenhang und ontologischen Status sie in widersprüchlichen Einzelaussagen grübele. Indem Kate von Namen zu Namen, von Strandgut zu Strandgut jage, nehme sie Anlauf zu einem Diskurs über eine verblassende Welt und auch über den schwindenden Status des eigenen (wie ich finde: immer noch kindlichen) Ich, sie nähere sich aus ihrer Sicht dem Prototyp halbbewussten literarischen Schreibens und sei letztlich doch zum Scheitern und Schweigen verurteilt. Kann die Betrachtung von Wallace, so stimmig sie für Marksons »Mätresse« zunächst ausfallen mag, vollends befriedigen, wenn die Perspektive auf Wittgensteins frühen »Tractatus« und die entsprechende Negativität der literarischen Botschaft fixiert bleibt? Marksons Kate bleibt so gewissermaßen in der »Tractatus«-Falle stecken. Sie wird auch als Schreibende als Objekt »traktiert« oder »tractatisiert«. Und es stellt sich die Frage, ob das interpretatorische Potenzial des Buches, auch im Hinblick auf Wittgensteins eigenes psycho-philosophisches Leben, damit wirklich ausgeschöpft ist. Demgegenüber wäre einzuwenden: Marksons Kunst, Kates anfänglich starre Gedanken und hölzerne Überlegungen immer geschmeidiger werden zu lassen, hinterlässt auch beim intellektuellen oder krimi-kombinatorischen Leser eine analoge ästhetische Wirkung, die eigene Lektüre fortschreitend zu nuancieren. Was zunächst wie eine Gedankenflucht oder eine Abwehr von Traumata wirkt, wird in der Folge immer verständlicher, als persönlich werdende Ausdrucksform, als heranreifende, verschlüsselte oder hier und da sich öffnende Selbstdarstellung Kates. Und ein nicht unwesentlicher Faktor dieser Selbstdarstellung besteht darin, den zunächst trockenen Schreibprozess über die Tatsächlichkeit der realen oder fiktiven Welt und die (Un-) Genauigkeit der beschriebenen Bildwelten immer stärker von der Ablenkung durch die Gedanken an die eigene Biographie oder die innere Befindlichkeit durchsetzen und verflüssigen zu lassen. Kates Schreibsituation findet nicht nur im Kopf-Gefängnis ihrer Kunstwelt statt, sondern ist und bleibt, zum Glück, provisorisch und existentiell und ist damit immer schon von den Störgeräuschen ihrer Erinnerung und ihrer angstbesetzten Gegenwart durchdrungen. Ihr Denken und ihre Existenz sind nicht kongruent, aber das Denken, das zunächst die Existenz verdrängt, nimmt erst dort fragmentarisch Souveränität an, wo es sich im Schreiben, in aller Unvollkommenheit, der Angst und Bedrückung stellt und ihr poetische und autobiographische Form gibt. Und Markson ist nirgendwo stärker in »Wittgensteins Mätresse« als dort, wo er Kate, völlig abgelenkt vom Pflichtprogramm des Titels, in weitere Digression verfallen lässt. David Foster Wallace hat in seinem Essay über den Wahlverwandten David Markson poetologische Prinzipien skizziert, die auch bei der ausführlicheren philosophischen Untersuchung seines eigenen Werkes hilfreich sein können. Hierbei wird Wittgenstein zweifellos eine prominente Rolle einnehmen. Durch die strikte Trennung der Ebenen Geist versus Existenz spaltet er allerdings den ganz normalen Schreibvorgang und das Alltagsleben einerseits in eine metaphysische Entität und andererseits in eine trivial-rest-empirische Entität auf. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Axt-Spaltungs-Methode die Achilles-Ferse der modernsten amerikanischen Literatur ist. Sie leidet unter einer Über-Ich-Schreib-Metaphysik. Jonathan Franzen hat durch die konsequente soziale Normalisierung seines Diskurses aus dieser akademischen Falle herauszufinden versucht. Wenn man Wallace’ striktere Perspektive beibehält, könnte es sich herausstellen, dass für eine angemessene Text- und Diskursanalyse neben bestimmten Konzepten aus dem »Tractatus« spätere Schlüsselbegriffe Wittgensteins von noch größerer Bedeutung sein werden. Ich meine damit vor allem die Theorie und Praxis vielschichtiger Sprachspiele. Und in ihnen müsste die Differenz von Kopf und Existenz, mündlicher Äußerung und spontaner Reaktion, schriftlicher Artikulation und intersubjektiver Verständigung weitere Aufschlüsse erhalten. Dann hätte Ludwig Wittgenstein, theoretisch und praktisch, nicht umsonst »gelitten«. |
David Markson |
||
|
|
|||
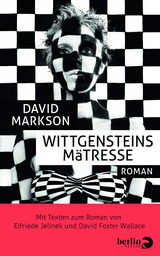 Ein
knöcheltiefer Kulturteppich
Ein
knöcheltiefer Kulturteppich