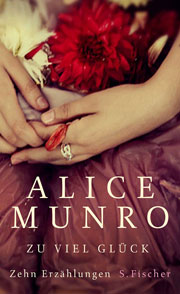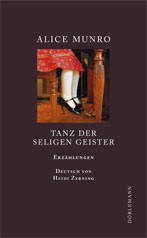|
|
Anzeige Versandkostenfrei bestellen! Versandkostenfrei bestellen!
Die menschliche Komödie als work in progress Ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. |
||||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | |||||
|
Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |
Es gibt Autoren, die seit
Jahren derart innig gelobt werden, dass man ihnen irgendwann nicht entkommen
kann. Die über die Jahre aufgebaute Erwartungshaltung
("Literaturnobelpreiskandidat!") führt fast zwangsläufig in eine Enttäuschung
(zumeist mittlerer Dimension): Naja, nicht schlecht – aber gleich Nobelpreis?
Wer empfehlen und überzeugen möchte, muss auch vergleichen. Aber hier beginnt dann zumeist das Dilemma: Was, wenn der andere dem Vergleich gar nicht zu folgen vermag? Empfehlungen spiegeln immer die Lebenswelt dessen wider, der sie ausspricht. Ein Vielleser hat eine andere Erwartung als ein Gelegenheitsleser. Freundschaften werden bei gezielten Buchgeschenken manchmal auf eine harte Probe gestellt. Ein Schriftsteller empfiehlt aus anderen Gründen als ein Literaturkritiker. Beiden attestieren die Leser eine gewisse Neutralität. Nichts könnte falscher sein. Und: Die Neutralität wäre sogar eher hinderlich, weil ja gerade die Subjektivität der Person, deren Empfehlung man folgt, erwünscht ist. Keine Instanz, deren der Leser sich bedient, ist frei von Ressentiments, Setzungen, Konzeptionen, Idealen und Wünschen. Und das ist ja einer der Gründe, warum man sich ihrer bedient. Alice Munro ist eine Autorin, die seit Jahren allseits gelobt und mit zuweilen rührendem Dackelblick empfohlen wird. Nicht nur von Jonathan Franzen, der nach Paula Fox 1996 die Munro für den amerikanischen Leser empfahl. Im deutschsprachigen Raum genießt die 1931 geborene Kanadierin schon lange mehr als nur den Ruf des Geheimtips. Regelmäßig überschlagen sich die Feuilletons mit Hymnen über diese Prosa. Ihre Neuerscheinungen werden inzwischen zeitnah ins Deutsche übersetzt. Die Autorin selber publiziert seit 1968 (mit durchaus größeren Pausen). Bis auf einen Roman ausschließlich Erzählungen – ein Phänomen, dass, weil so untypisch (= unkommerziell) für den (deutschsprachigen) Buchmarkt, einige Kritiker besonders für sie einnimmt. Die untypische Titelgeschichte So geht man denn mit dem Ballast der gut(gemeint)en Empfehlungen an ein Buch wie "Zu viel Glück" heran. Auf 365 Seiten gibt es zehn Geschichten. Die Titelgeschichte ist die längste mit fast 60 Seiten und steht am Ende. Sie ist untypisch für die anderen neun Erzählungen und überrascht mit einem emphatischen, zuweilen pathetischen Ton. Es geht um eine reale Person, der russischen Mathematikerin Sofia Kowalewskaja (1850-1891). In einem kleinen Nachwort zeigt sich Munros Verbundenheit mit dieser Persönlichkeit. Erzählt wird in Rückblenden ihre für die damalige Zeit ungewöhnliche Karriere – als Frau im Wissenschaftsbetrieb des 19. Jahrhunderts zu reüssieren. Seit 1884 war sie Professorin an der Universität Stockholm. Sie galt als mathematische Koryphäe, verfasste auch eine Autobiographie mit ihren Kindheitserinnerungen und engagierte sich politisch für Frauenrechte. Munro entwickelt das Tableau des Lebens dieser bemerkenswerten Frau auf der langwierigen und strapaziösen Zugreise im kalten Februar 1891 von Paris über Berlin nach Stockholm. Privates und Berufliches gehen in einem großen Erinnerungsstrom ineinander. Der Leser erfährt von ihrer hohen Begabung, den Problemen, die eine Frau im wissenschaftlichen Kosmos des 19. Jahrhunderts hatte und von ihren Zweifeln, sich wieder neu zu verheiraten, da ihr Bräutigam mit einer zum Teil erschreckenden Kälte auf ihre Briefe antwortet. Wenige Tage nach der Ankunft in Stockholm stirbt Kowalewskaja überraschend an einer Lungenentzündung. "Zu viel Glück" sollen ihre letzten Worte gewesen sein. Am Ende bewundert man Munros Vielseitigkeit, die einem vorher mit ihrer Mischung aus spröder Erbarmungslosigkeit, fast gekünstelter Kälte, die als Lakonie missverstanden werden könnte, und seinem Tick Suspense à la Chabrol verblüffte (und auch ein bisschen nervte). Ihre Hauptfiguren sind meist Frauen der weißen (kanadischen) Mittelschicht, die häufig durch ein einschneidendes Ereignis aus der normalen "Bahn" des Lebens geworfen wurden. So fährt in der ersten Geschichte ("Dimensionen") die 23jährige Doree mit dem Bus zu Lloyd. Doree arbeitet unter ihrem zweiten Vornamen Fleur ambitionslos als Zimmermädchen in einem Hotel. Sie hat eine andere Frisur als "damals" und eine Menge abgenommen. Warum? Lloyd war - wie sich später herausstellt - ihr Mann. Behutsam wird die Geschichte vom Kennenlernen der beiden erzählt. Sie heiraten und in schneller Folge stellen sich drei Kinder ein. Lloyd wird mit der Zeit immer merkwürdiger und sogar Dorees Freundschaft zur wesentlich emanzipierteren Maggie missfällt ihm. Lloyd wird zum Paranoiker. Und als sich Doree eines Abends bei Maggie einfindet und dort übernachtet, nimmt die Katastrophe seinen Lauf. Am nächsten Tag kommt sie zurück und Lloyd hat die Kinder umgebracht. Sie waren schon tot, als sie ihn am Abend vorher angerufen hatte. All dies entwickelt sich im Lauf der Erzählung, der Fahrt mit den Bussen zu der Anstalt, in der Lloyd, der ehemalige Krankenpfleger, einsitzt. Sie besucht ihn, bricht den Kontakt wieder ab, nimmt ihn wieder auf. Wechselbad der Gefühle. Etliches bleibt der Phantasie des Lesers überlassen und gibt Raum für Spekulation. Lloyd lebt in einer anderen Welt, schickt Doree merkwürdige Briefe (in denen er ihr beschreibt, wie er die Kinder im Himmel sieht). Als sie Lloyd wieder besuchen will, ereignet sich während der Fahrt mit dem Bus ein schwerer Unfall. Ein Mann wird aus seinem Auto herausgeschleudert. Doree gelingt es, ihn wiederzubeleben, weil sie sich an Lloyds Unterweisungen eventuelle für Notfälle mit den Kindern erinnert. In diesem Moment erkennt sie, dass ihr Besuch nicht notwendig ist. "Sie müssen nicht nach London?" fragt der Busfahrer und sie antwortet Nein. »Nichts persönliches« In "Erzählungen" wird von einem Aussteigerehepaar erzählt. Jon ist Schreiner in der Provinz; Joyce unterrichtet an der Schule Musik. In die Idylle erscheint Erie, die als Lehrling bei Jon anfängt. Erie ist das Gegenteil von Joyce – nicht besonders gebildet, mit einem Alkoholproblem, tätowiert; von abweisender Schüchternheit. Sie war wie ein Haustier. Aber es geschieht etwas mit Jon. Eines Tages bemerkt Joyce, dass er in Erie verliebt ist. Es kommt zur Trennung. Die Erzählung macht einen jähen Schnitt. Jahre später ist Joyce die dritte Ehefrau von Matt, einem hoch angesehen Neuropsychologen in der Vancouver Society. Er wird 65 Jahre alt und auch seine beiden Ex-Frauen sind zur Geburtstagsfeier gekommen. Dort lernt sie Christie kennen, eine junge Schriftstellerin. Es stellt sich heraus, dass Christie Eries Tochter ist und in einer Erzählung Joyces Unterricht mit ihr als Kind verarbeitet hat. Als sich Joyce nach einer Lesung in die Schlange derjenigen stellt, die das Buch von Christie signiert haben möchten, offenbart sie sich ihr nicht. Und da ist die Geschichte auch schon zu Ende. Manchmal sind diese Erzählungen fast rhapsodisch und es gibt am Schluss nur lose Enden. Dies sind dann zuweilen kompliziert gebaute Rätselkonstrukte, die nur annährungsweise durch den Leser aufzulösen sind und sich jeglicher stringenten Auflösung verweigern. In der Erzählung "Tieflöcher" wird auf noch nicht einmal dreißig Seiten das Leben von Kent erzählt. Kent stürzte als Kind bei einem Familienausflug im Wald in ein Loch und brach sich beide Beine. Dennoch schien seine Karriere vorgezeichnet: exzellente Noten an der Highschool. Seine wissenschaftliche Laufbahn schien so klar. Dann kam es anders. Nach sechs Monaten auf dem College verschwand Kent heißt es lapidar. Er arbeitete in einem Laden in Toronto als Autoreifenverkäufer. Plötzlich ist er weg. Nach drei Jahren kam ein Brief aus Kalifornien. Er schrieb seitenweise von seinem eigenen Leben. Nicht von dessen praktischer Seite, sondern davon, was er seiner Überzeugung nach damit anfangen sollte – und anfing. Er plädiert für das Aufgeben des intellektuellen Hochmuts und erzählt von einem Nahtoderlebnis. Ein Auflehnungspamphlet ohne Bezug auf seine Familie; nach seinen Geschwistern erkundigt er sich nicht, weil er keine Antwort will. Und wieder Jahre später entdeckt Sally, Kents Mutter, ihren Sohn im Fernsehen, wie er bei einem Großfeuer hilft. Es gelingt ihr, Kent ausfindig und die beiden treffen sich. Er war völlig ergraut, einige Zähne fehlten, sein Gesicht zerfurcht, der Körper hager; er hinkte. Er umarmte sie nicht - was sie auch nicht erwartete – legte ihr aber leicht die Hand auf den Rücken, um sie in die Richtung zu lenken, in die er mit ihr gehen wollte. Kent, einst Hoffnung der Familie, ist ein Bettler, lebt zumeist auf der Straße. Das Versprechen, in Verbindung zu bleiben – es dürfte Makulatur sein. Sie zittert vor Wut Und dann: Verachtung. Nein. Darum geht es nicht. Nichts Persönliches. Die Fragilität der Idylle Idyllen sind die Ausgangspunkte. Kleinste Veränderungen vermögen diese zu zerstören und ein ganzes Leben zu prägen. In "Kinderspiel" erzählt eine Marlene die Geschichte von ihr und Charlene. Sie lernten sich in einem Sommer-Ferienlager irgendwann in den 50er Jahren kennen. Ein Ferienlager, in dem Mittelschichteltern ihre Kinder für einige Wochen ruhigen Gewissens abgeben können. Es sind, wie sich später herausstellt, die schönsten zwei Wochen im Leben von Marlene. Kurz vor Ende der Zeit bekommen sie Besuch von Sonderlinge[n], Kindern aus sozial schwächeren Familien, denen der Aufenthalt für einige Tage durch karitative Organisationen ermöglicht wird. Mit dabei ist überraschend auch Marlenes Nachbarskind Verna, eine Sonderschülerin mit merkwürdigen Verhaltensweisen, mit denen Marlene überfordert ist. Sie hatte Charlene vorher von Verna erzählt und sie als eine Art asoziales Schreckgespenst dargestellt. Pünktlich zur Ankunft der Sonderlinge, auf die, wie die Lagerleiterin in einer Ansprache betont, besonders viel Rücksicht zu nehmen ist, verschlechtert sich das Wetter. Die letzte Bademöglichkeit bevor die Kinder abgeholt werden (und die "Sonderlinge" in den Bus verbracht werden), findet in gedrückter Stimmung statt. Jahre später sieht sie Charlenes Hochzeitsphoto in der Zeitung. Und vielleicht fünfzehn Jahre später erhielt sie einen Brief von Charlene über Marlenes Verlag. Beide Male hatte sie überlegt, mit Charlene Kontakt aufzunehmen, dies jedoch verworfen. Diese Verweigerungshaltung mutet merkwürdig an, zumal die zwei Wochen im Lager mit derartiger Glückseligkeit erinnert wurden. Schließlich erhält Marlene einen Brief, in dem ihr mitgeteilt wird, dass Charlene schwer krebskrank in einem Krankenhaus liegt und den unbedingten Wunsch hat, sie noch einmal zu sehen. Sie entschließt nach einigem Zögern hinzugehen. Charlene schläft jedoch unter Sedativa. Die Pflegerin drückt ihr einen Brief in die Hand. In diesem Brief bittet Charlene ihre ehemalige Freundin zu einem Pfarrer zu gehen. Der Leser beginnt zu ahnen, dass Munro die letzten Stunden des Ferienlagers nicht zu Ende erzählt hat. Marlene trifft den Pfarrer nicht an. Man will ihn holen. Während sie auf ihn wartet, kommen ihr die Erinnerungen. In einem Anfall aus Übermut und Hass hatten die beiden Freundinnen beim letzten Schwimmen am See des Ferienlagers Vernas Kopf so lange unter Wasser gedrückt, bis diese tot war. Bis man das Mädchen vermisste, waren die beiden von ihren Eltern abgeholt worden. Diese Tat hat beide Leben geprägt. Es bleibt offen, ob eine Vergebung, eine Sühne, möglich ist. In der Erzählung "Freie Radikale" gibt es am Ende sogar eine moralische Pointe. Eine krebskranke Frau, die ihren eigentlich gesunden Mann durch einen plötzlichen Herzanfall verliert wird in ihrem Haus überfallen. Der Täter gesteht ihr drei Morde, die er eben begangen hat und zeigt der verstörten Frau die Fotos der Leichen. Es scheint so, als habe er es auf ihr Auto abgesehen. Die Frau ahnt, dass sie auch in Lebensgefahr ist und beginnt, einen nicht begangenen Mord zu gestehen, damit er sie selber verschont. Während der bedrohlichen Szenerie merkt sie, wie die Tatsache, dass sie unrettbar an Krebs erkrankt ist, ihre Todesangst nur kurz verdrängt. Ihre Geschichte erfüllt jedoch ihren Zweck, die Frau bleibt unversehrt und der Mann fährt mit dem gestohlenen Auto davon. Schließlich wird sie vom klopfenden Polizisten geweckt. Der Mann erlitt einen Unfall und war sofort tot. So unterschiedlich die einzelnen Erzählungen auch sind - charakteristisch ist, dass nicht viele Worte gemacht werden. Das ist nur scheinbar ein Paradoxon. Tode werden fast immer wie beiläufig, in ein, zwei Sätzen beschrieben; als erzähle sie von einem Ausflug. Indem das vermeintlich Große nicht als solches erscheint, bekommt das Kleine, scheinbar Unbedeutende, einen höheren Wert. Der Grad der Erschütterungen der Figuren bleibt geheimnisvoll. Nach außen erscheinen sie unbeeindruckt, während sie im Innern wüten. Dieses Wüten muss der Leser aus den Spuren, die Munro legt, erahnen. Warum Doree an jenem Abend Maggie aufgesucht hatte, was genau Jon an Erie faszinierte, wie Christie die Unterrichtsstunden mit Joyce empfand, warum Kent vom College ging, was die depressive Frau veranlaßte, ihren Mann im Wald zu suchen – der Leser erfährt es nicht. Hinzu kommt, dass Munro mit den unterschiedlichen Informationsgraden spielt. Leser, Haupt- und Nebenfiguren haben nicht den gleichen Stand. Dies macht den Reiz dieser Prosa aus: Einerseits wird man in eine hermetische Situation hineingezogen. Andererseits verbleibt genügend Raum für Phantasie, Spekulation. Was man ansonsten jeder Kurzgeschichte als Makel ankreiden würde – hier wird es als besondere Kunst zelebriert. Mehr als die Konstruktion der Geschichten und deren Chronologie bleibt die evozierte Stimmung in Erinnerung. Es ist eine Melange aus Hoffnungslosigkeit und Sehnsucht, Ausgeliefertsein und trotzigem Selbstbehauptungswillen, die sich immer wieder abwechseln. Munros Figuren sind Gezeichnete. Sie bleiben zumeist unter ihren Möglichkeiten. Eine Geschichte endet mit dem Satz Ich wurde erwachsen und alt. Wie griechische Helden, die ihrem Schicksal nicht entkommen können, so haften die Schicksale an ihnen. Alice Munro erzählt von diesen Umständen auf ihre unprätentiöse, kühle Art. Es ist ein schmaler Grat für den Leser: Er kann sich dieser Stimmung hingeben und in ihr schwelgen. Oder er kann sich durch den bloßen Konsum der Geschichten der Welt entziehen und alles von sich weisen. Wer die erste Variante wählt, wird von Alice Munros Erzählungen fasziniert sein. Kommt dann noch eine Spur Identifikation mit der jeweiligen ProtagonistIn hinzu, dürfte es um den Leser geschehen sein. Eignet man sich jedoch die Kühle und Distanz der Autorin selber an, so bleibt außer stilistischer Bewunderung und dem ein oder anderen Bild wenig. Man klappt am Ende das Buch zu. Und bestellt noch einen Cappuccino.
Die kursiv gesetzten
Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch. |
Alice Munro
Siehe auch:
|
|||
|
|
|||||