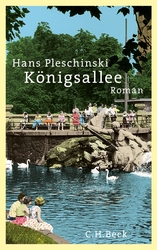|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit18.09.13 |
Schatten der Vergangenheit
Hans Pleschinskis Thomas-Mann-Roman »Königsallee« |
||
|
Die Blicke trafen sich. Thomas Mann legte den Kopf in den Nacken, schloß die Augen. Klaus Heuser räusperte sich auf den Handrücken. Bewunderer mußten warten. Der Dichter schien sich auf die Lippen zu heißen, die offenbar sogar zitterten. Heuser trat einen halben Schritt vor: «Das geht nicht gut,» Thomas Mann schaute ihn frontal an. Das alte Gesicht mit leichten Tränensäcken war nicht mehr starr, nicht mehr ganz hoheitsvoll, sondern unmerklich durchzuckt von einem rasenden Weh, Kummer, und ein Lächeln auf beider Münder erlosch in einem Versuch.
«Ich kann doch jetzt nicht
weinen?» Was hier geschildert wird, ist die Wiedersehensszene zwischen dem 79jährigen Dichter Thomas Mann (1875-1955) und dem Malersohn Klaus Heuser (1917-1994). Ort der Handlung ist der noble und berühmte »Breidenbacher Hof« an der Düsseldorfer Königsallee im August 1954. So eindrucksvoll authentisch Hans Pleschinski die äußeren Umstände und das Treffen auch schildert – es fand tatsächlich nie statt. Real ist alleine der Besuch des Dichters in Düsseldorf. Wer war Klaus Heuser? Über die homosexuellen Tendenzen in Thomas Manns Wesen hatte es jahrzehntelang wenig öffentliche Diskurse und Veröffentlichungen gegeben. Das Thema pikierte vermutlich manchen eher konservativen Zeitgeist und passte nicht so recht auf die akademische Bühne einer Gesellschaft, die erst 1994 eine ersatzlose Streichung der Strafnorm des § 175 StGB vorgenommen hat.
Der erste veröffentlichte
Band der Tagebücher gewährte 1977 Einblick in das »Klaus-Heuser-Kapitel«. Der
Sohn des Direktors der Düsseldorfer Kunstakademie hatte am 12. August 1933 den
im südfranzösischen Exil lebenden Dichter besucht. Sechs Jahre zuvor hatten sich
die Familien Mann und Heuser während eines Urlaubes in Kampen auf Sylt
kennengelernt. Der siebzehnjährige Sohn der Heusers hatte es dem
Literaturnobelpreisträger angetan; Klaus Heuser wurde nach München in die
Poschingerstraße eingeladen, wo er im September/Oktober 1927 vierzehn Tage in
der Villa der Manns verbrachte. Seinen beiden ältesten sich gerade auf einer
Weltreise befindenden Sprösslingen Erika und Klaus schrieb der Vater über den
jungen Gast:
In keinem Treffen zwischen
Thomas Mann und dem jungen Mann geschah etwas wirklich Anrüchiges, dennoch
erschütterte und beschwingte Heuser die Seelenlage des Dichters zutiefst – auch
und vor allem in literarischer Hinsicht, wie es in »Königsallee« zum Ausdruck
kommt: Immer wenn sich Thomas Mann dieser Inspiration im Tagebuch widmet, schwingt ein Ton der Erfüllung mit. «Las lange in alten Tagebüchern aus der Klaus Heuser-Zeit, da ich ein glücklicher Liebhaber», findet sich unter dem 20. Februar 1942. «Das Schönste und Rührendste der Abschied in München, als ich zum ersten Mal (den Sprung ins Traumhafte) tat und seine Schläfe an meine lehnte. Nun ja, – gelebt und geliebt. Schwarze Augen, die Tränen vergossen für mich, geliebte Lippen, die ich küßte, – es war da, auch ich hatte es, ich werde es mir sagen können, wenn ich sterbe.» In den Tagebüchern taucht der Name Klaus Heuser immer wieder auf, nicht nur im September 1935 anlässlich einer Wiederbegegnung im Zürcher Exil, sondern stets dann, wenn Thomas Manns literarische Werkstatt für eine erotische Episode eine entsprechende Anregung benötigte und dieser Zweck noch einmal ein Vertiefen in die Tagebücher von 1927, der Zeit der ersten Begegnung, erforderlich machte. Thomas Mann im »Breidenbacher Hof« Was wäre also gewesen, wenn der große Dichter seine Inspiration auch noch einmal am Spätabend seines Lebens unerwartet wiedergetroffen hätte? Diese Frage spielt Hans Pleschinski in seinem Roman durch. Er lässt den aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrten Thomas Mann aus Anlass einer Lesung aus seinem jüngsten Roman »Felix Krull« nach Düsseldorf kommen. Begleitet wird er von Ehefrau Katja und der »Tochter-Adjudantin« Erika. Beide Frauen wachen mit Argusaugen über das Wohl Thomas Manns. Schon recht früh, nach ihrer Ankunft im »Breidenbacher Hof«, erfahren sie auch von Klaus Heuser, der mit seinem Lebensgefährten, dem aus Sumatra stammenden Anwar, – ebenfalls nach vielen Jahren in der Fremde – in seine Heimat nach Düsseldorf zurückgekehrt und im gleichen Hotel abgestiegen ist. Die beiden Frauen befürchten schlimmste seelische Irritationen beim Autor der »Buddenbrooks«, wenn er seine Inspiration aus Sylter und Münchener Tagen wiedertrifft.
Vor allem Erika Mann ist
angesichts dieser Möglichkeit außer sich. Pleschinski zeichnet ein recht
authentisches Bild, wie sich die älteste Tochter, Thomas Manns wichtigste
Ratgeberin, Lektorin und Beschützerin in Personalunion, vermutlich tatsächlich
in dieser heiklen Situation verhalten hätte. Das Wiedersehen wird jedoch nicht wie befürchtet zum seelischen Fiasko für Thomas Mann; es verläuft vielmehr in einer Atmosphäre von Melancholie und Vertrautheit. Klaus Heuser und vermutlich nur ihm, gelingt es bei dem kurzen Treffen zwischen Golo Mann und seinem Vater zu vermitteln. Gleiches gelingt ihm andeutungsweise auch zwischen dem früheren Freund Ernst Bertram (1884-1957) und dem Dichter. Sowohl der vom Vater nicht so sehr geschätzte Golo, als auch Bertram, der um Absolution für sein im Dritten Reich gezeigtes Verhalten bittet, hatten Heuser im Vorfeld um Vermittlung gebeten. Beide wussten um dessen möglichen Einfluss. Das Interview mit Fräulein Kückebein Neben diesem Hauptstrang des Romans um die fiktive Wiederbegegnung ragt auch das Kapitel »Besuch von der Trave« um das Interview der kleinwüchsigen Journalistin Gudrun Kückebein von den »Lübecker Nachrichten« heraus. Mit einer Mischung aus Bewunderung, Ehrfurcht, aber vor allem unerschrockener journalistischer Raffinesse bringt Fräulein Kückebein den berühmten Interviewpartner, aber auch dessen Gattin Katja, mehr als einmal aus der Fassung. So traut sie sich u.a. zu bemerken: «Es war, Thomas Mann, alles andere als ein Bündnis mit dem Bösen, das Sie eingingen. Aber, sehen Sie’s mir nach, verdanken Sie einen Teil Ihrer Bedeutung nicht ebenjenem Kampf gegen den Verbrecherischen? Sind Sie Adolf Hitler nicht in vielfältiger Weise triumphal verbunden? Verpflichtet?»
Katja Mann versuchte sich
zu fassen, wobei sie von ihrem Gatten die Bemerkung «tolldreist, das ist
schlimmer als phantastisch» aufschnappte und die Kückebein vor Spannung schier
zerbarst. Das Kückebein-Interview spiegelt den kritischen Umgang mit Thomas Mann wieder – die Journalistin agiert sozusagen als Antipodin zu den Beschützerinnen Katja und Erika, den vielen Bewunderern, die sich im »Breidenbacher Hof« die Klinke in die Hand geben und natürlich auch zu Klaus Heuser, mit dem es zu einem versöhnlichen Ende kommt, wenn die beiden den Park von Schloss Benrath aufsuchen – einem Symbol für die ewige Liebe, das Blühen und Vergehen. Der Autor
Hans Pleschinski (Jahrgang
1956) ist zweifellos ein großer Kenner von Thomas Mann und den Seinen. Er
skizziert vortrefflich deren Eigenarten und nimmt den Leser zugleich auf eine
Wiedererkennungsreise durch die biografische Zitatenwelt der Manns (z.B.:
«Die Eri muß immer die Suppe salzen, wenn Sie verstehen, was das meint.»),
wie auch des Werks des »Zauberers« (u.a. »Lotte in Weimar«). |
Königsallee |
||
|
|
|||