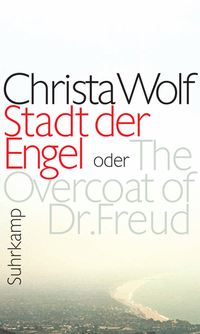|
Bücher & Themen

Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Glanz & Elend
empfiehlt:
50 Longseller mit
Qualitätsgarantie
Jazz aus der Tube u.a. Sounds
Bücher, CDs, DVDs & Links
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.»

|
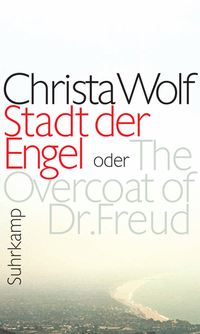 Substitution
unbewältigter Trauerarbeit? Substitution
unbewältigter Trauerarbeit?
Über
Christa Wolfs Autotherapeutikum
»Stadt der Engel«
Von Peter V. Brinkemper
Christa Wolfs »Stadt der
Engel oder The Overcoat of Dr. Freud« ist ein pseudo-epischer Bluff. Eine
Sommerlektüre voller spätlinker Weltwut und Politikmüdigkeit. Ein ozeanisch
aufgepepptes, restromantisches Muschelbiedermeier. Ein nachträglich
ausgeschriebenes, nach eigener Erklärung in manchen Personen und Situationen
fiktionalisiertes Reisetagebuch in Ich-Form. Bestenfalls vergleichbar mit Thomas
Manns Tagebuchliteratur und dem Roman zum Roman, »Die Entstehung des Doktor
Faustus«. Entstanden anlässlich eines Aufenthaltes der Autorin als
Getty-Stipendiatin im Land des ehemals auftragsbeschaffenden Großen Gegners USA
1992/93, in einem Land kurz nach der Zeit der DDR, das zwischen Bush Senior und
Clinton immer wieder Krisen und Züge kriegerischer Entgleisung zeigt, mitten im
medial verblödeten Wohlstand, It’s the economy, stupid. Es ist für Christa Wolf
die Zeit der Enttäuschung und der kulturpolitischen Spießrutenläufe durch das
West-Feuilleton, anlässlich der Erzählung »Was bleibt« (1990), in der ihre
offene Stasi-Überwachung seit 1976 zum Thema wird. Dazu kommt die Enttarnung
Wolfs 1993 als, wenn auch harmlose Inoffizielle Mitarbeiterin Margarete1959 bis
1962 in den Stasi-Akten. Das zerrissen inszenierte Ich in »Stadt der Engel«
erhält zunächst kein episches Relief, das über einen privatistischen, vor-politischen
und vor-poetologischen Schmerz hinauswüchse. Es herrscht eine anhängliche Trauer
vor: über sich selbst und den plötzlich wie aus Himmelshöhen oder vom Erdboden
verschwundenen Mauervolksstaat. Dieses Ich nimmt in Amerika Asyl, Auszeit und
Urlaub von sich selbst. Die Feier dieses Buches als Roman auf dem Klappentext
ist fraglich, herausgekommen ist ein romanhaftes und essayhaftes, nur leicht
poetisches Betroffenheits-Tagebuch, ein Medienhype des vorläufig in die Berliner
Pappelallee umgezogenen Verlages, der bereits, Frankfurt am Main untreu, auf den
versammelten Berlinischen Weltgeist auf dem Friedhof der Dorotheenstädtischen
und Friedrichswerderschen Gemeinden schielt.
Wolfs Verdienst: Die Unteilbarkeit des Himmels
Das Ich und seine
Identität bleiben in Wolfs neuem Werk so unbestimmt naturalistisch und zugleich
traumhaft-traumatisch wie jener der Wirklichkeit abgeschaute Witz am Anfang, in
die USA mit dem noch gültigen Pass der
»GDR«
einzureisen.
»Are you sure this country
does exist? – Yes, I am, antwortete ich knapp, das weiß ich noch, obwohl die
korrekte Antwort >>no<< gewesen wäre«.
Vieles in diesem »Roman« ist Substitution unbewältigter
Trauerarbeit, vielleicht auch polit-poetische Halsstarrigkeit oder Unfähigkeit,
das Danach zu begreifen, ohne das Davor zu vergessen. Die Nachwehen der in
rasantem Tempo aufgelösten DDR sitzen tief im Herzen einer psychokonspirativ
staatspatriotischen Autorin, die seit ihrem verdienstvollen Debüt in den 60ern,
bei aller Nachdenklichkeit und Reserve im und gegen das System in
Ostdeutschland, immer auch Züge einer idealisierenden Musterschülerin hatte, die
zwischen Parteidisziplin, Spitzengesprächen, Lektoratstätigkeit und Leiden im
Dienste des eigenen Schriftstellertums die unmögliche realexistierende linke
Balance suchte, zwischen dichterischem Anspruch, individueller Biographie und
sozialer Wirklichkeit. Christa Wolf hatte und hat ihre Leserinnen und Leser in
Ost und West, zu Recht, zumal in der Projektion des »geteilten Himmels«, dem
zwischen liebenden Individuen personalisierten Dialog- und Konkurrenzspiel von
Kapitalismus und Kommunismus, zwischen vorgeblicher strategischer
Selbstbehauptung und gemeinsamer Selbstverwirklichung. Wie viel davon im Alltag
der DDR bis zum Mauerfall de facto möglich war, konnte nur der konkrete
Vergleich zwischen Privilegierten, auch ins Ausland reisenden Sportlern,
Politikern, Künstlern, Wissenschaftlern, Intellektuellen und den ganz normalen
Insassen des speziell-deutschen Sozialismus erweisen.
Heiner Müller hat das auch
stimmig in seiner 4.November 1989-Rede in Berlin ausgedrückt: »Ein Ergebnis
bisheriger DDR-Politik ist die Trennung der Künstler von der Bevölkerung durch
Privilegien. Wir brauchen Solidarität statt Privilegien.«
Nun kann man den Himmel
gar nicht wirklich teilen, trotz aller territorialen Vermachtungen und
Bewaffnungen, weder beim Dachdecken, noch in der Stratosphäre noch in der
Philosophie, noch in der rasanten globalen Verflechtung heute, es sei denn, man
verficht einen paranoiden Monotheismus der eigenen Werte im Angesicht des
apokalyptisch dämonisierten Gegners.
Der Maßstab für Poetik und Roman:
»Kassandra«
Christa Wolfs neuster
»Roman«
verhält sich zu einem wirklich epischen Werk, wie die Frankfurter
Poetik-Vorlesung »Voraussetzungen
einer Erzählung«
zu der ebenfalls 1983 erschienenen Erzählung
»Kassandra«.
»Kassandra«
ist das durchaus angreifbare, aber in polemisch-poetischer Verve verfasste
knappe Meisterwerk und Erfolgsbuch der 80er Jahre, zwischen anklagender
Frauenstimme und nüchterner Darstellung der archaischen Rituale
militant-korrupter Männerherrlichkeit. Was Christa Wolf in der Figur der
Kassandra tatsächlich und für das Publikum spürbar in epischer Form
verdichtete, war die weibliche Sicht der von Apoll mit dem Sehen begabten und
verfluchten, durch die Griechen vergewaltigten und verelendeten Frau, die vom
griechischen Heerführer Agamemnon nach der Vernichtung ihrer Heimat Troja als
Kriegsbeute zurück nach Mykene mitgeschleift wird, bevor er und sein Gefolge,
angestiftet von seiner Gemahlin Klytaimnestra, wegen seiner ruchlosen
Bereitschaft, sogar die gemeinsame Tochter Iphigenie für den Krieg zu opfern,
hasserfüllt ermordet wurde. Die Orestie jenseits der klassischen Goetheschen
Befriedung als mitgefühlter blutiger Finalakt von
»Kassandra“
am »viereckigen«
Mykenischen Tor, als tödliche Endstation des
»totalen«
Siegers im trojanischen Krieg, dem schon die Homerische Ilias, mit ihrem um den
heroischen Zorn des halbgöttlichen Cowboy-Söldners Achill kreisenden
Heldentheater und olympischen Götterpoker, kein positives Porträt, sondern das
Schmachbild eines feigen, hinterhältigen Intriganten gönnte. Der Abstieg einer
anerkannten Königstochter, Seherin und Repräsentantin einer friedlichen
zivilisierten Kultur in Kleinasien zur fast blinden und doch wieder anders
sehenden Gefangenen und Geächteten, in einer Familien-Trutzburg, die vom
Machtwillen und der Kriegslust der griechischen Eroberer Agamemnon und Menelaos
mit dem spartanischen Helena-Nato-Bündnis-Trick angesteckt war und in der ein
Stasi-morpher oder BND- und MAD-konformer Eumelos seine Propaganda- und
Spitzelpolitik trieb, - alles dies konnte nicht nur als ein einfaches Modell für
die DDR und den Kalten Krieg gelten, sondern für die systemübergreifende
Selbsterniedrigung des Menschen durch den Menschen als Apparatschik, der
Degradierung vom Subjekt zum Objekt, zur Konsum-, Bett- & Kriegshure (»Achill,
das Vieh«),
in der frühen Antike und in der Gegenwart der Hochrüstung zwischen West und Ost,
einer Ära des Umbruchs und des möglich werdenden Abbaus atomarer Bedrohung durch
rockig und literarisch flankierte Abrüstungs- und Friedens-Proteste in der
gesamten Welt.
Die »Voraussetzungen« zu
»Kassandra« waren und sind ein Ideen-, Arbeits- und Reisetagebuch, voll von
poetologischen, kulturhistorischen und gesellschaftlichen Reflexionen, auf der
Suche nach einem weiblichen Schreiben, das sich nicht in einer Frauenecke
verkroch, sondern auf gesellschaftliches Gehör setzte. Wenn man einen
produktiven Vorwurf gegenüber der Christa Wolf der frühen 80er Jahre haben
könnte, dann den: Sie hätte die diskursive Rationalität ihrer poetischen
Ausführungen und die aufgebrachte Emotionalität ihrer Erzählung zu einem
doppelstimmigen, kontrapunktischen Roman zusammenfügen können. In der Literatur
und im Leben. Noch als Echo auf diesen Kontext heißt es nun: »Warum aber kam mir
der Konflikt des Orest, der Iphigenie menschlich vor, der unserer Atomphysiker
aber unmenschlich, fragte ich Peter Gutman«.
Zum Vergleich:
Ein matter Überzieher, aber doch mit einer Geburtsodyssee
Verglichen mit diesem Gedankenmodell von oft brillanter Reflexion und
vehementer Erzählung fällt »Stadt der Engel« zunächst eher quengelig und
bisweilen mau aus. Der »Overcoat of Dr. Freud« bleibt ein stellenweise
unterhaltsamer, doch insgesamt matter Überzieher, ein Zaubermantel mit zarten
Zipfeln einer mutmaßlich tieferen Wahrheit, mag sein, für Fans und
kulturstasiförmige Kritiker. Wolf begibt sich auf die Spur der deutschen
Exilanten in L. A. Selbst immer noch wie angewurzelt stehen geblieben, als
vormaliges Subjekt der Vorstellung des einstmals geschlossenen Systems, will sie
Passagen über die Erfahrung des Exils exzerpieren, Proben nehmen, einordnen,
verstehen lernen, wie in einem von außen gestellten Experiment: »Was es hieß,
wurzellos zu sein. Und zu erfahren, dass niemand, kein Einheimischer in ihren
Exilländern und erst recht keiner ihrer ehemaligen Landsleute, ermessen konnte,
wie die Jahre in dieser Schattenexistenz sie veränderten.« Die Verbindung nach
Berlin schrumpft auf das Telefon. Immerhin outet sich Wolf, die den Luxus des
kleinen Badezimmers dem großen vorzieht, bald als Star-Trek-Anhängerin, weil die
Enterprise die »edlen Werte der Erdenbewohner in die fernsten Galaxien“ trage.
Auch vor der Teilnahme an nächtlichen Gesprächen der Stipendiaten, Freunde und
Bekannte, die man so kennen lernt, selbst über Entführungen und
Schwängerungen durch Außerirdische in Fliegenden Untertassen, scheut sie nicht
zurück. Ein Hauch von californischem Nerdism schwebt durch diese Zeilen.
Allmählich bewegt sie sich von einem Brother-»Maschinchen« auf erste PC-und
Internet-Erfahrungen zu. Sie ist von der brutalen Direktheit der
US-Medienbilder, vom Elektrischen Stuhl, über Madonnas Sex-Buch und »Magic«
Johnsons umstrittenes Basketball-Comeback trotz HIV-Infektion, schockiert.
Schuberts »Winterreise« muss für das durchgängige Entfremdungsgefühl herhalten.
In den menschelnden Gesprächen und Betrachtungen gibt es oft nur eine
marshmallow-weiche Logik. An der himmlisch temperierten Westküste geht es auch
im Clinton-Wahlkampf euphorisch, aber politisch korrekt zu. Man lebt wieder auf,
nach dem zweiten Golfkrieg, zwischen Hussein und Bush Senior, man duckt sich bei
letzten Raketenschlägen gegen Bagdad, verfolgt die ersten Probleme der
demokratischen Regierung: Mit dem Grundsatz »Don’t ask, don’t tell« wird die
harte Homophobie in der Armee nur halbherzig bekämpft, es folgt die brachiale
Auslöschung der Waco-Sekte in Texas durch das FBI und das Ende des
Rodney-King-Prozesses. Brav dümpeln die Intellektuellen aller Nationen vor sich
hin, riskieren hier und da mal einen Spruch: »If Clinton doesn’t win, I have to
leave my country.« Eine romantisch-liberale Übertreibung, born and made in the
USA, die Christa Wolfs Verschraubung in ihren alten Problemstaat seltsam
leichtsinnig durch die Ideologie universeller Wahl konterkariert. Immerhin
schreit ein Francesco anlässlich Paul Flemings Sonett »An sich« (»Nimm dein
Verhängnis an, lass alles unbereut.«) über das protestantische Deutschtum in
traditionskritischer Manier heraus: »Eure Selbstunterdrückung bringt ja das
ganze Unglück hervor!«
Der Leser atmet kurz auf. Andererseits gebe es auch für die anbrechende Ära
Clinton wenig echten Enthusiasmus unter den US-Bürgern. Ein wirklich packender
epischer Stoff will sich bei soviel medialer und touristischer Nachbereitung
nicht einstellen, ist vielleicht auch nicht intendiert. Wolf ist auf ihre Weise
bereits im Neuen Second Life angekommen, die Poetik der Fremd- und
Selbstbeobachtung hilft ihr dabei. Ähnliches gilt für Wolfs Rolle bei ihrem
Projekt der Aufarbeitung des durch ein halbes Jahrhundert zwischen Kapitalismus,
Sozialismus, Faschismus und Stalinismus gehenden Briefwechsels zwischen ihrer
Freundin Emma und einer ihr zunächst unbekannten Adressatin mit dem Kürzel L.
(Lily), die sich als radikale, lebenslustige und leidensfähige Anarchistin in
politischen, privaten und philosophischen Angelegenheiten erweist. Immer
wieder arbeitet Wolf ihre aktuelle Bedrängnis durch die Veröffentlichung ihrer
IM-Stasi-Tätigkeit in Deutschland mühsam am Freudschen Imperativ ab: »Ohne
Vergessen könnten wir nicht leben.« Bertolt Brechts Vers über Los Angeles als
Äquivalent für die Hölle, die für Shelley in London lag, kommt ihr gelegen. Am
Ende reihen sich Szenarien beliebig aneinander und lassen kein touristisches
Klischee aus: der Gospel-Gottesdienst in der First African Methodist Episcopal
Church, in der Spielhölle von Las Vegas, die Salzwüste, der
Universal-Film-Themenpark von Hitchcocks »Psycho« und »Sabotage« (Der Fall von
der Freiheitsstatue) bis Spielbergs »Der Weiße Hai« und »E.T.«, das Hearst
Castle, eine Inspiration für den von Wolf unterschätzten Welles-Klassiker
»Citizen Kane«, die Atombomben-Entwicklung und Erstzündung in Los Alamos, New
Mexiko, der Grand Canyon, die Navajo- und Hopi-Indianer. Auch die konfliktreiche
Exilgeschichte deutscher Emigranten wird nur oberflächlich angerissen. Nur an
einer Stelle verdichtet sich im Small Talk die subjektive Historiographie, beim
sicheren Gespür für Brecht und seinen zweiten »Galilei« und Thomas Mann und
seinen zwölftönig komponierten »Doktor Faustus« (beide 1947) in Hollywood.
Bedenklich bieder und eintönig bleiben die Reminiszenzen an die politische und
dichterische Parteidisziplin in der DDR. Schließlich kommt doch Fahrt und
Bewegung in den Text, vielleicht auch, weil Christa Wolf aus der umfriedeten
Künstler- und Gelehrtenkolonie des CENTER on the road geht.
Einarmige Banditen - Warum
nicht mehr Marx?
Nicht vorzuwerfen ist der Autorin, dass sie daran leidet,
dass die DDR als eigenständiger Staat nach 1989, nach dem Jubiläumsbesuch
Gorbatschows, dem Zerbröckeln der alten Macht, den Botschafts-Flüchtlingen, den
staatskritischen Freiheits-Demonstrationen, dem Mauerfall und den ersten
wirklich demokratischen Volkskammerwahlen, nicht weiter existierte. Die DDR war
und blieb kein alternatives Reformprojekt oder konföderatives Gebilde neben der
Bundesrepublik. Christa Wolfs alte und neue DDR waren nicht von dieser Welt,
City of Angels and City of Devils. Die Kontinuität des alten zwillingshaften
Systems zwischen sportlicher Konkurrenz, Subversion und Subvention bleibt ein
altlinker Schattenwunsch, der heute mit dem allseits hofierten Wirrwar des
parakommunistischen und demokratiezerstörenden Turbokapitalismus in China
konfrontiert wird.
»Doch
die Verhältnisse, die sind nicht so.«
Oft stöbert die von Wolf inszenierte Erinnerungsarbeit wie verstört in den
Zitaten, Quellen und Erinnerungen, verunklart die Chronologie des normalen
Tagebuchs und der empfundenen Biographie. Christa Wolf erinnert daran, dass
Soldaten auf den Dächern am Berliner Alexanderplatz am Tage ihrer Rede auf der
Großen Demonstration vom 4. November 1989
den Schießbefehl (für den Fall, dass die Demonstranten vom Weg abwichen und
zum Brandenburger Tor in den Westen durchbrachen) nicht vollzogen und ihre
Vorgesetzten
zum 9. November
vorsorglich die Munition einsammelten. Christa Wolf plädierte in
ihrer Rede für einen staatsloyalen Reformkurs und gegen politische Wendehälse
und Republikflüchtige:
»'Traum'.
Also träumen wir mit hellwacher Vernunft: Stell dir vor, es ist Sozialismus, und
keiner geht weg! Sehen aber die Bilder der immer noch Weggehenden, fragen uns:
Was tun? Und hören als Echo die Antwort: Was tun!«
Dies ist ein letztes äußerstes Plädoyer für den Staat, nicht aber die Menschen,
die ihn als einfache Bürger und Mediengestalten abschafften? Ein
atemberaubendes Szenario: Was musste an wirklicher Zivilcourage, einsichtiger
Vorsorge und kluger Besonnenheit zusammenkommen, um den durchweg
gewaltfreien Erfolg der
»Nachholenden
Revolution«
(Jürgen Habermas) durchzusetzen, die den rasanten
institutionellen Ausgleich des Demokratiedefizits in allen osteuropäischen
Staaten brachte. Der weitergehende deutsch-deutsche Annäherungs-Prozess war auch
durch die um 1989/1990 von unten demokratisierte DDR und die Umsetzung von
Bürgerprotest und Bürgerbegehren in erstmalig freie formelle Wahlen ohne
Parteidiktatur nicht aufzuhalten. Für die Mehrheit ging es nicht um Reform,
sondern um Vereinigung mit der BRD und damit faktisch um die Liquidierung der
DDR. Auch heute noch kann man den übereilten ökonomisch orientierten Anschluss
der neuen Bundesländer an den Westen zum Zwecke der CDU-Mehrheitsbeschaffung und
der europäischen West-Dominanz monieren. Eine Kritik, wie sie nicht nur im
Osten, sondern auch im Westen an Kohls schön-schnellem Weg zur Einheit laut
wurde und sie auch heute noch gilt, im opportunistischen Merkel-Zeitalter und in
der Phase der endlichen Annäherung der Westparteien an die böse Linke als
Koalitionspartner.
»Stadt der Engel« ist ein
larmoyant-unterhaltsames »Roman«-»Tagebuch« -Pastiche, das die aufgebrochene
Geschichtlichkeit der Nach-Bush-Senior-Ära und den postkommunistischen
Revisionseifer 1992/3 wunderlich atmet, aber gerade, weil es erst 2010
erscheint, auch einen völlig anderen Ton hätte anschlagen können. Reicht die
linke Freizeit-Wellness am Pazifischen Ozean für die dem System kaum entronnene,
ungeteilte Himmelsanbeterin und idealistische Kindheitsmusterpoetin? Ist dies
die einzig richtige Kur, auch mit Blick auf die überhitzte postsowjetische und (ost-)europäische
Situation? Der Literatur um 2000 täte eine neuste Marxsche Bissigkeit gut. Dies,
mit Verlaub, als Einwand, angesichts des Pyrrhus-Sieges eines dreisten
Bindestrich-Kapitalismus (Raubtier-Heuschrecken-Turbo-Doping-Casino usw.), der
sich hastig im Sinne von Good Old Marx von einer Finanz- und Öko-Krise in die
nächste stürzt und dabei alle heutigen und ehemaligen Weltmächte und Weltbürger
empfindlich schwächt. Christa Wolf, erlöse uns von den einarmigen Banditen,
nicht nur in Las Vegas, sondern überall.
|
Christa Wolf
Stadt der Engel
Roman
Suhrkamp
416 Seiten
24,80 €
ISBN: 978-3-518-42050-8
Leseprobe |
 Glanz&Elend
Glanz&Elend