|
Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 01.05.13 |
Ein Interview mit der Übersetzerin
Gudrun Hermle
|
||
|
»Mein Name ist Natalis Delpierre«, stellt sich der Ich-Erzähler des Reiseromans »Der Weg nach Frankreich« gleich zu Beginn vor – ein Name, den deutsche Jules-Verne-Leser bis dato nicht kannten. Hierzulande sind die Namen von Phileas Fogg (in »In 80 Tagen um die Erde«) oder Kapitän Nemo (in »20.000 Meilen unter den Meeren« oder »Die geheimnisvolle Insel«) ein Begriff. Aber Natalis Delpierre? »Ich werde nun also von mir berichten, allerdings nur, um das wiederzugeben, was ich während meines Urlaubs in Deutschland gesehen oder getan habe«, erklärt dieser uns Deutschen bislang unbekannte »neue« Jules-Verne-Held. Er berichtet eine Begebenheit aus der Revolutionszeit von 1793: Kurz vor der preußischen Kriegserklärung an Frankreich war er nach Belzingen in Deutschland gereist, um seine Schwester Irma zu besuchen, die bei einer französischstämmigen Frau Keller als Dienerin beschäftigt war. Deren Sohn Jean bereitet gerade seine Hochzeit mit der Französin Marthe de Lauranay vor, als die Trauung durch den Kriegsausbruch verhindert wird. Jean wird in die Armee eingezogen und gezwungen, gegen seine geistige Heimat Frankreich zu kämpfen. Delpierre, Irma und die Lauranays müssen binnen 20 Tagen das Feindesland verlassen. Allerlei Schikanen und Demütigungen ausgesetzt, macht sich die kleine Gruppe unter Natalis’ Führung auf den beschwerlichen Heimweg durch das feindselige Teutonenland. Im Thüringer Wald kommt es zu einer unerwarteten Begegnung mit Frau Keller und ihrem Sohn: Jean ist desertiert, nachdem er seinen ehemaligen Rivalen und derzeitigen Vorgesetzten, Leutnant von Grawert, geschlagen hat. Von Kopfgeldjägern verfolgt, erreichen die Gruppe die Grenze und flüchtet sich in das kleine Dorf Croix-aux-Bois. Hier sind aber schon die Österreicher einmarschiert; auch die Preußen stoßen hinzu. Delpierre und Jean werden gefasst und sollen hingerichtet werden. Im letzten Moment drängt ein Gegenangriff der französischen Truppen die Invasoren zurück. Es kommt zur Schlacht bei Valmy, während der sich Jean an seinem Peiniger von Grawert rächen kann. Die Geschichte des Romans Die Geschichte um Natalis Delpierres abenteuerliche Reise durch das Land des Kriegsgegners erschien ursprünglich unter dem Titel ›Le Chemin de France‹ in 25 Folgen als Fortsetzungsroman in der Zeitung ›Le Temps‹ (Paris) vom 31. August 1887 bis zum 30. September 1887. Im unmittelbaren Anschluss an den Zeitschriftenerstabdruck war der Roman im Oktober 1887 als broschiertes und kartoniertes Buch im Kleinformat durch Vernes Hausverleger Jules Hetzel erschienen. Im November folgte dann die illustrierte großformatige Buchausgabe mit 37 Illustrationen von Georges Roux (1850-1929) und zwei Karten. Bislang war der Roman als einziger der Serie ›Voyages Extraordinaires‹ nicht ins Deutsche übersetzt worden. Über die Gründe dafür kann nach wie vor spekuliert werden. Von Experten werden verschiedene Erklärungen vorgebracht, so etwa Vernes deutschfeindliche Haltung, die von zeitgenössischen deutschsprachigen Verlagen wie Hartleben nicht akzeptiert worden sei. Diese These kollidiert jedoch mit dem Faktum, dass z.B. Vernes ›Die 500 Millionen der Begum‹ (1879) mit seinen deftigen antideutschen Charakterisierungen schon sehr früh den Weg in den deutschen Sprachraum gefunden hat. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, so erscheint eine solche Zurückhaltung deutscher Verlage heute mehr als hinfällig zu sein. Das sagte sich offenkundig Ende letzten Jahres jedenfalls die Edition Dornbrunnen – Verlag Sven R. Schulz, die für eine Premierenveröffentlichung von ›Le Chemin de France‹ in deutscher Sprache sorgte. Ins Deutsche übertragen wurde der historische Reiseroman von der Heidelberger Übersetzerin Gudrun Hermle. Die Publizierung folgt einem allgemeinen literarischen Trend in den letzten Jahren, in denen eine ganze Reihe großer Klassiker ihre Premierenveröffentlichung in deutscher Sprache erlebt haben: Zu denken ist etwa an ›Der Graf von Sainte-Hermine‹ von Alexandre Dumas (Vater) bei Random House oder Robert Louis Stevensons ›Das Licht der Flüsse‹ im Aufbau Verlag. Dasselbe Unternehmen präsentierte im letzten Jahr erstmalig auch die Sachbuchsensation ›Meine geheime Autobiographie‹ des amerikanischen Humoristen Mark Twain. Im Zuge dieser Entwicklung war auch die Veröffentlichung von »Der Weg nach Frankreich« in Deutschland nur eine Frage der Zeit gewesen. Anlass genug für ein Gespräch mit der Übersetzerin. Interview mit der Übersetzerin Gudrun Hermle(Jürgen Seul): Hallo Gudrun, wie bist Du Übersetzerin geworden und warum übersetzt Du gerne Bücher? (Gudrun Hermle): Es hat mich schon immer fasziniert, in andere Sprachen und somit in andere Kulturen einzutauchen. Wer eine fremde Sprache spricht, eröffnet sich Horizonte, die ansonsten verborgen bleiben würden. Die Tätigkeit des Übersetzens war für mich insofern ungeachtet des gezielten Übersetzerstudiums daher eher der zweite interessante Aspekt an der Beherrschung der Fremdsprache. Nach wie vor liebe ich auch den Kontrast zwischen der französischen und der russischen Sprache, stelle fest, dass ich selbst »ein wenig anders bin«, wenn ich russisch oder französisch spreche. Sprachen sind mehr als Kommunikationsmittel, sie sind der Ausdruck einer Kultur und bieten Zugang zu Menschen und Sichtweisen, die auch das eigene Weltbild verändern. Bücher übersetze ich gerne, weil ich mich ausführlich in einen neuen Bereich einarbeiten kann und oftmals dabei »eine neue Welt« betrete. (J.S.): Wie sieht ein typischer Arbeitstag als Übersetzerin bei Dir aus? (G.H.): Den zeitlichen Rahmen gibt zunächst meine Familie vor. Ist mein kleiner Sohn zu Hause, ist das Arbeiten so gut wie unmöglich! Doch wenn alle »versorgt« sind, verbringe ich den größten Teil des Tages am Computer. Inzwischen läuft das Meiste über das Internet, d.h. ich erhalte meine Texte per E-Mail, übersetze sie und sende sie dann wieder auf dem elektronischen Wege zurück an den Auftraggeber. Doch je nach Text gönne ich mir etwas Abwechslung. Handelt es sich nicht um allzu schwierige Inhalte, so setze ich mich in mein Lieblingscafé und übersetze dort an meinem Laptop. Die Geräuschkulisse stört mich nicht, manchmal bringen mich Wortfetzen, die zu mir dringen, sogar auf bestimmte Formulierungen. Zudem kann ich besonders gut nachdenken, wenn ich das geschäftige Treiben auf der Straße beobachte. Wörterbücher benötige ich dabei so gut wie nicht mehr. Fehlt mir doch mal ein Wort, so helfen moderne Kommunikationsmittel wie das I-Phone, über das ich ein Online-Wörterbuch oder eine entsprechende Site, auf der der Begriff erklärt ist, aufrufen kann. Tja, und leider sind es in der Regel 7 Tage in der Woche, in der ich am Computer sitze…. (J.S.): Wie gehst Du bei der Übersetzung vor? Liest Du z.B. ein Buch vor einer Übersetzung vollständig? (G.H.): Nein, ich lese mir ganz grundsätzlich einen Text niemals vorher ganz durch. Das hat man uns zwar an der Uni gelehrt, aber dazu fehlt im Alltag schlicht und einfach die Zeit! Natürlich überfliege ich einen Text, um mir einen Eindruck von dem Thema und dem Schwierigkeitsgrad zu verschaffen, aber mehr auch nicht. In einem ersten Schritt erfolgt dann eine wortwörtliche Übersetzung. Beim ersten Durchlesen versuche ich, mich von den allzu wörtlichen Formulierungen wegzubewegen, eine weitere vergleichende Korrektur zeigt mir, ob ich auch nichts vergessen habe und ein letzter Korrekturgang schließlich dient dazu, eine optimale Lesbarkeit des Texts zu gewährleisten (und natürlich noch ein paar Fehler, die meistens beim Umformulieren entstehen, aufzuspüren). (J.S.): Wie hältst Du es mit den Übersetzungstheorien? (G.H.): Ich sehe mich eher als Anhängerin der rationalistischen Schule. Natürlich ist eine 1:1 Übersetzung Utopie, aber ich denke schon, dass das, was der Autor sagen möchte, so hinübergebracht werden kann. Dazu muss man natürlich erstens die Kultur hervorragend kennen und zum anderen auch vor allem »fühlen«, was der Autor sagen möchte. Ein Beispiel – sagt bei uns jemand »Sie baden gerade Ihre Hände drin«, so verbinden die Älteren von uns damit ein ganz bestimmtes Bild aus dem Werbefernsehen. Ein Autor, der dies aus welchen Grund auch immer erwähnt, will auf der einen Seite dieses bestimmte Bild wachrufen, sicherlich aber auch eine Prise Humor mit in den Text bringen. Würde der Übersetzer dies nun 1:1 übersetzen, könnte kein Franzose damit etwas anfangen. Eine Erklärung des Werbespots wäre sehr schwerfällig und würde die Spritzigkeit der Erwähnung dieses Spruchs an dieser Stelle kaputtmachen. Wichtig ist es in einem solchen Fall, etwas »Entsprechendes« in der Fremdsprache zu finden, etwas, was ähnliche Assoziationen weckt und dabei auch die Prise Humor nicht vernachlässigt. Dazu muss man natürlich die Kultur und den Alltag in dem anderen Land genau kennen. Das ist nicht einfach, manchmal denke ich über solche Dinge tagelang nach und versuche »nachzuspüren«, ob die Assoziationen übereinstimmen. In dieser Hinsicht hat das Übersetzen auch etwas mit »Spüren« zu tun. (J.S.): Kommen wir zu Jules Verne: Welche Rolle spielte dieser Schriftsteller bisher in Deinem Leben? (G.H.): Jules Verne hat mich schon immer fasziniert. Ich denke, er ist ein Autor, den viele in der Jugend »verschlingen« und das war auch bei mir nicht anders. Seine Ideen faszinieren, insbesondere angesichts der Zeit, in der er sie zu Papier brachte. (J.S.): Wie kam es nun zu dem konkreten Projekt, den bislang in Deutschland nicht vorliegenden Roman »Der Weg nach Frankreich« zu übersetzen? (G.H.): Der deutsche Jules-Verne Club kam mit diesem Projekt auf mich zu. Ich war sofort von der Idee begeistert, einen Jules Verne zu übersetzen, doch da ich in der Zeit nochmals Mutter wurde, zudem sehr viele Übersetzungen habe und auch noch mit Russland zusammenarbeite (im Bereich der Medizintechnik), hat es letztendlich doch vier Jahre gedauert, bis das Buch übersetzt wurde. (J.S.): Wie wirkt Jules Vernes Stil auf Dich? (G.H.): Der Stil ist schon nicht ganz einfach. Die Übertragung ins Deutsche ist dabei jedoch die kleinere Hürde, oftmals ist es eher schwierig zu verstehen, was er überhaupt meinte. Stieß ich an meine Grenzen, so habe ich immer wieder französische Kollegen befragt, die sehr häufig dieselben Verständnisprobleme hatten wie ich. Die Sprache ist insofern in der Tat etwas antiquiert, doch hat man verstanden, was er sagen will, so bietet auch unsere Sprache die Möglichkeit, dies »hinüberzubringen«. Schwierig war manchmal allerdings die Mehrdeutigkeit seiner Worte, sodass ich doch auf erklärende Fußnoten zurückgreifen musste, auch wenn ich diese gerne vermeide. Ein Beispiel war der »poulailler«, der Hühnerstall, in dem ein paar Plünderer in einem verlassenen Dorf auf ein paar »Hühnchen« stoßen. Doch der poulailler ist auch der oberste Rang im Theater, von dem der Zuschauer das Treiben beobachtet. Da hilft dann schon eine Anmerkung, da Verne sicherlich beide Bedeutungen im Kopf hatte. (J.S.): Wie zu hören war spielt ein nordfranzösischer Dialekt, dass »Picardische«, in Vernes Roman eine besondere Rolle. Stellte dieser Umstand eine große Schwierigkeit bei der Übersetzung dar? (G.H.): Ja, denn es gab picardische Ausdrücke, die ich weder wortwörtlich noch in einer »normalen Sprache« übersetzen konnte, denn oftmals sagt der Erzähler ja in einem Nachsatz »wie wir in der Picardie sagen«. Dies war eine Gratwanderung. Ich musste einen Ausdruck finden, der den Inhalt wiedergab, gleichzeitig aber etwas, aber nicht allzu ungewöhnlich klang und den Leser den Kopf schütteln ließ. Ein Beispiel: So wird am Anfang gesagt: »je n’étais pas sur mes œufs, comme disent les Picards.« Wörtlich heißt das: »Ich war nicht mehr auf meinen Eiern, wie die Pikarden sagen«. Das kann man unmöglich so schreiben. Tatsächlich soll es heißen, dass die Person nicht gerade viel Geld bei sich führt. Das kann man so einfach auch nicht schreiben, weil dann das »wie die Picarden sagen« nicht passt. Ich habe daraus gemacht: »Außerdem hatte ich keinen Sack voller Eier bei mir, wie man bei uns in der Picardie sagt. Ich besaß nur die mageren Ersparnisse meines Solds«. Letztlich konnte ich, auch mit Hilfe des Internets und eines aus der Picardie stammenden Vaters einer Übersetzerkollegin, alles klären. (J.S.): Gab es noch weitere sprachliche Schwierigkeiten? (G.H.): Schwierig war es auch mit Vernes Schreibweise deutscher Ortsnamen. Die Bezeichnungen waren manchmal bis zur Unkenntlichkeit verfälscht, klangen gar »verballhornt« und manchmal verwechselte Verne auch Ortschaften. Ein Beispiel: In dem Roman ist von »Belzingen« die Rede, gemeint ist aber »Belzig«. Tatsächlich gibt es beide Ortschaften in Thüringen, aber nur mit genauer Ortskenntnis war es möglich, hier der Verwechslung von Verne auf die Spur zu kommen. Nicht zuletzt war Verne auch in geschichtlichen Dingen nicht immer ganz korrekt. Auf diese Unstimmigkeiten musste man auch erst einmal kommen. Das Gleiche gilt, wenn er die Namen von Generälen manchmal falsch und manchmal richtig schrieb. (J.S.): Was hat Dir bei der Übersetzung von »Der Weg nach Frankreich« am besten gefallen? Es hat mir gut gefallen, die französische Sprache noch näher kennengelernt zu haben; von einer Seite, die zum Teil sogar für Franzosen zumindest mittlerweile ungewohnt ist. Zudem hat es mir auch gefallen, manchmal tagelang über eine Formulierung nachzudenken und schließlich, vielleicht gerade bei einem Einkauf auf dem Markt oder wann auch immer, auf eine Formulierung zu kommen, die für mich vom Gefühl her mit dem Originaltext übereinstimmte. (J.S.): Wie findest Du den Roman vom Inhalt her selber? (G.H.): Die geschichtlichen Hintergründe fand ich sehr interessant. Anfangs fesselte mich die Geschichte weniger, doch gegen Ende wurde es richtig spannend, sodass ich mit Spannung das Geschehen verfolgte, während ich übersetzte. (J.S.): Was hältst Du allgemein von der Idee, unveröffentlichte »alter Klassiker« erstmalig ins Deutsche zu übersetzen? (G.H.): Eine sehr gute Idee. Es gibt nichts, was dagegen spricht! Jedes Werk aus der Vergangenheit gibt einen Einblick in die damaligen Lebens- und Denkweisen. (J.S.): Warum sollten die deutschen Leser von heute einen »neuen« Jules Verne lesen? (G.H.): Insbesondere dieser Roman zeigt eine »neue« Seite von Jules Verne, die nichts mit seinen »Science-Fiction-Romanen« zu tun hat. Wer einen solchen Roman erwartet, wird sicherlich enttäuscht. Aber Verne zeichnet ein sehr interessantes Bild der damaligen Geschehnisse und gibt auf eine recht beklemmende Weise wieder, wie schlecht es damals um die deutsch-französische Beziehungen stand. Der Roman ist somit eine Zeitreise und gibt einen Einblick in das persönliche Schicksal eines Menschen, der in diese Geschehnisse hineingerissen wird. (J.S.): Würdest Du noch einmal einen Klassiker wie Jules Verne übersetzen wollen? (G.H.): Ja, natürlich, eine tolle Herausforderung. (J.S.): Was hast Du in den kommenden Monaten für Projekte? (G.H.): Im Moment übersetze ich Texte aus dem Gesundheitsbereich, derzeit geht es dabei um eine Nahrungsergänzung, die die Bildung von Stammzellen anregen soll. Auch das ist interessant und ich lerne viel Neues. Überhaupt nutze ich gerade in Gesundheitsdingen einiges, was ich aus meinen Büchern gelernt habe. So habe ich beispielsweise ein Buch über Grapefruitkernextrakt übersetzt, ein tolles natürliches Mittel. Es haben sogar einige Leser meine Telefonnummer herausgefunden und mich angerufen, um mir zu danken und zu sagen, wie sehr sie von diesem Buch profitiert haben. (J.S.): Vielen Dank für das Interview! Hast Du noch einige letzte Worte an unsere Leser? (G.H.): Ich denke, die Leser sollten sich darüber bewusst sein, dass ein Übersetzer seine Aufgabe perfekt erfüllt hat, wenn man überhaupt nicht merkt, dass das Werk übersetzt ist. Insofern mag es niemals auffallen, welche Arbeit hinter einem gut übersetzten Werk steckt. Doch genau das ist ja eigentlich das Ziel – niemand soll »die Übersetzung riechen« können, wie die Franzosen so schön sagen. |
Jules
Verne |
||
|
|
|||
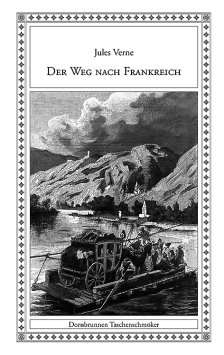 Eine
literarische Premiere:
Eine
literarische Premiere: