|
Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
| Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |
»...
die abgeworfenen Häute
meines Selbst.« »Ich muss Ihnen nicht erst sagen, dass eine gedankenlose Nachahmung der Natur nicht in Frage kommt. Bitte denken Sie immer an diesen Grundsatz – den wichtigsten, den ich Ihnen mitgeben kann. Wenn Sie einen Gegenstand darstellen wollen, bedarf es zweier Elemente: Erstens muss die Identifikation mit dem Gegenstand vollkommen sein, und zweitens müsste noch etwas völlig anderes im Spiel sein. Dieses zweite Element lässt sich nur schwer erklären. Fast so schwer, wie sein eigenes Selbst zu finden. Tatsächlich suchen wir alle eben dieses Element unseres eigenen Selbst.« Mit diesen Worten trat Max Beckmann (geb. 1884 in Leipzig, gest. 1950 in New York) im September 1947 vor seine erste amerikanische Malklasse an der Washington University, nachdem er nur wenige Monate zuvor sein bitter empfundenes Exil in Amsterdam verließ und mit seiner zweiten Frau Quappi nach Amerika auswanderte. Die an seine Studenten gerichteten Worte wurden schnell zur programmatischen Erklärung von Beckmanns Werk und Werkprozess. Beidem kann man im Herbst in drei fast zeitgleich stattfindenden Ausstellungen nachspüren. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Herangehensweisen bringen die Bilderschauen in Leipzig, Basel und Frankfurt/Main dem Besucher nahe, wie auch Beckmann stets auf der Suche nach diesem eigenen Selbst war und wie sich dieses Selbst in seinen Bildern wiederfand. Die drei Werkschauen, die, zufällig parallel geplant, nun als einvernehmliches Großprojekt erscheinen, fügen sich wie ein Beckmann-Triptychon zu einem Ganzen, welches zwar unterschiedliche Aspekte ins Auge fasst, aber dennoch ein Gesamtbild entstehen lässt. Sie bieten eine einmalige Gelegenheit, sich umfassend mit dem Werk von Max Beckmann zu befassen.
Die Baseler Schau folgt Beckmanns Lebensweg und strukturiert sein Landschaftswerk in fünf Stationen: Weimar und Berlin 1902 – 1914, Frankfurt/Main 1915-1933, Berlin 1933 – 1937, Amsterdam 1937 – 1947, Amerika 1047 – 1950. Diese Anordnung kommt Beckmanns stark biografisch geprägtem Landschaftswerk, das mit Industrieabbildungen, Fensterblicken und Stadtansichten von einem stark gedehnten Begriff der Landschaft bis Gebrauch macht, entgegen. Ausgangs- und Angelpunkt ist das als entartete Kunst von den Nationalsozialisten aus dem Frankfurter Städel-Museum entfernte Gemälde Das Nizza in Frankfurt am Main, welches seit 1939 im Besitz des Hauses ist. Die Kuratoren Bernhard Mendes Bürgi und Nina Peter haben aber auch selten zu sehende Stücke, die sich in Privatbesitz befinden und zum Teil seit Jahrzehnten nicht zu sehen waren, wie etwa Hermsdorfer Wald oder Blaues Meer mit Strandkörben, in Basel versammelt. Betrachtet man die knapp 70 in Basel ausgestellten Landschaften – angefangen bei Große Buhne von 1905 und endend mit Mühle im Eukalyptuswald aus dem Sommer 1950 – kann man Beckmanns Suche nach dem eigenen Selbst nachempfinden. Er begegnet sich hier selbst, verortet sich und seine Zeit in den Landschaftsbildern, reagiert auf die Orte seines Aufenthalts und träumt sich – insbesondere im Amsterdamer Exil – an andere Orte. In den dort entstandenen Gemälden, vor allem in den Meeresbildern, findet sich Beckmanns innere und äußere Lebenssituation immer wieder in düsteren Stimmungen gespiegelt. Beispielhaft seien hier das Triptychon-ähnliche Arrangement der drei Gemälde Nordseelandschaft I, Stürmische See, Wangerooge und Nordseelandschaft II, die den Zyklus eines Naturereignisses und zugleich Beckmanns Lebensängste abbilden, genannt. Der Traum als Mittel, das »völlig andere« im Bild umzusetzen, spielt bei Beckmanns Landschaften eine besondere Rolle, denn sie sind vielmehr Traumbilder, als realistische Abbildungen der Landschaften. Es sind oft Erinnerungsaufnahmen mit realem Bezug, in denen Beckmann die wahrgenommene Atmosphäre mit persönlichen Stimmungen und den äußeren Anfechtungen seiner Zeit verdichtet hat. Postkarten und selbst angefertigte Skizzen dienten ihm meist als Grundlage seiner subjektivistisch geprägten Erinnerungsbilder. Der Tagebucheintrag vom 8. September 1940, an den der Kunsthistoriker Hans Belting im Begleitband erinnert, macht dies deutlich: »Nochmals – was ich geschaffen habe, sind nur die abgeworfenen Häute meines Selbst.« Der direkten Konfrontation mit seinem Selbst kann man in idealer Weise in Leipzig nachgehen. Die Ausstellung in Beckmanns Geburtsort steht unter dem Motto Von Angesicht zu Angesicht und versammelt nach fast 50 Jahren erstmals wieder eine Vielzahl von Porträt-, Familien- und Gruppenbildnissen, die in Beckmanns Lebenswerk eine wichtige Rolle einnehmen. Neben rund 50 Gemälden sind in Leipzig auch etwa 100 Druckgrafiken und Skizzen versammelt. Zuletzt war eine solche Portrait-Schau Max Beckmanns 1963 im Badischen Kunstverein zu sehen.
Die
Leipziger Ausstellungsmacher gehen aber noch weiter und bedienen sich dabei
einem weit gefassten Porträtbegriff, um zu veranschaulichen, was Kunstsammler
und Beckmann-Freund Stephan Lackner einst als »malerisches Welttheater
Beckmanns« bezeichnete. Um das Mythologische, ein aus der Malerei nicht
wegzudenkendes Element, am Alltäglichen zu verifizieren, greift Beckmann auf die
kulissenhafte Inszenierung zurück. Alltagsbeobachtungen, etwa aus dem Zirkus
oder dem Varieté, paart er mit symbolisch ausgestatteten und ikonographisch
aufgeladenen Figuren mit bereits bekannten Gesichtern.
Als er in den USA ankam, war er dort bereits ein Star. Im MOMA hängt seine Kunst an der Seite von Pablo Picasso, Fernand Léger und Henri Matisse. Die Demütigung der Entartung seiner Kunst und der Vertreibung ins Exil kann er hier endlich hinter sich lassen. Mit der kunsthistorischen Entwicklung des europäischen Expressionismus hin zu einem amerikanischen Stil, dem Abstrakten Expressionismus, zelebriert von Jackson Pollock, Mark Rothko oder William De Kooning, setzte sich Beckmann nicht auseinander. Es komme darauf an, ob ein Bild genügend innere Substanz habe, nicht aber, ob es diesem »Geschrei der Avantgarde« angehöre. Das war alles, was er dazu zu sagen hatte.
»Nicht mit den Ohren sollt
ihr sehen, sondern mit den Augen! In jeder Kunstform kann Ungewöhnliches
erreicht werden und es hängt allein von der produktiven Fantasie des Beschauers
ab, das zu entdecken.« |
Stephan Reimertz
Max Beckmann
Max Beckmann
Beckmann & Amerika
|
|
|
|
|||

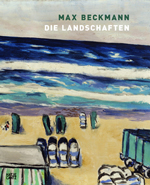 Im
Kunstmuseum Basel, welches bekannt dafür ist, einzelne Aspekte eines
Künstlerwerkes der Retrospektive vorzuziehen, wendet sich Beckmanns
Landschaften zu. Als Maler der condition humaine hat Beckmann das
Landschaftsbild auf grandiose Weise (sein Landschaftswerk umfasst etwa 250
Gemälde) erneuert. In einer Zeit, in der der Gattungsbegriff nahezu aufgelöst
wurde, greift Beckmann für seine Landschaftsmalereien auf den klassischen
Begriff der Landschaftsmalerei zurück. Er experimentiert mit den Grenzen dieses
Gattungsbegriffs. Der sensible Blick auf die Natur und deren Wirkung auf die
seelische Verfasstheit des Menschen – diese von Caspar David Friedrich
übernommenen Leitlinien des Landschaftsbegriffs finden sich auch bei Beckmann
wieder, wenngleich bei ihm weniger die Natur auf seine Verfasstheit wirkt, als
vielmehr seine Verfasstheit auf die Wahrnehmung der Landschaft. Keine
unwesentliche Rolle spielt dabei Beckmanns von Henri Rousseau angeregtes
Interesse an der Natur und der Position des Menschen darin, über die er Zeit
seines Lebens sinnierte.
Im
Kunstmuseum Basel, welches bekannt dafür ist, einzelne Aspekte eines
Künstlerwerkes der Retrospektive vorzuziehen, wendet sich Beckmanns
Landschaften zu. Als Maler der condition humaine hat Beckmann das
Landschaftsbild auf grandiose Weise (sein Landschaftswerk umfasst etwa 250
Gemälde) erneuert. In einer Zeit, in der der Gattungsbegriff nahezu aufgelöst
wurde, greift Beckmann für seine Landschaftsmalereien auf den klassischen
Begriff der Landschaftsmalerei zurück. Er experimentiert mit den Grenzen dieses
Gattungsbegriffs. Der sensible Blick auf die Natur und deren Wirkung auf die
seelische Verfasstheit des Menschen – diese von Caspar David Friedrich
übernommenen Leitlinien des Landschaftsbegriffs finden sich auch bei Beckmann
wieder, wenngleich bei ihm weniger die Natur auf seine Verfasstheit wirkt, als
vielmehr seine Verfasstheit auf die Wahrnehmung der Landschaft. Keine
unwesentliche Rolle spielt dabei Beckmanns von Henri Rousseau angeregtes
Interesse an der Natur und der Position des Menschen darin, über die er Zeit
seines Lebens sinnierte.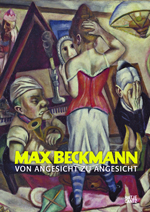
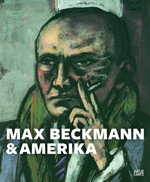 Im
Frankfurter Städel begleitet die Retrospektive Max Beckmann & Amerika
die sukzessive Eröffnung des Museumsneubaus. Sie wendet sich mit etwa 50
Gemälden und 60 Zeichnungen Beckmanns letzter Werkphase zu, die nicht minder
produktiv und mythologisch ist, zeigt aber auch Gemälde, die viele Jahre vor der
Emigration entstanden sind und zur belastenden Vorgeschichte der Verbannung
gehören (Kreuzabnahme, Der Befreite, Die Weintraube). Als
Beckmann 1947 das verhasste Exil in Amsterdam verlässt und nach Amerika
auswandert, ist das für ihn wie eine Befreiung. Der zwangsweise Exilierte wird
zum freiwillig Emigrierten. »14 Jahre exilé / et condamné / nun wieder frei –
sehen wir was weiter kommt«, notiert er 1946, bereits ein Jahr vor seiner
Ausreise, als er einige seiner Werke nach New York schicken darf. Noch drei
Jahre nach seiner Ausreise später erinnert er sich vor Freunden an das
befreiende Gefühl der Überfahrt nach Amerika: »Sie können nicht ermessen, was
das für ein innerer Umschwung war für mich, in dies friedliche Land zu kommen,
nach den furchtbaren Zerstörungen, die ich in Europa miterleben musste.«
Im
Frankfurter Städel begleitet die Retrospektive Max Beckmann & Amerika
die sukzessive Eröffnung des Museumsneubaus. Sie wendet sich mit etwa 50
Gemälden und 60 Zeichnungen Beckmanns letzter Werkphase zu, die nicht minder
produktiv und mythologisch ist, zeigt aber auch Gemälde, die viele Jahre vor der
Emigration entstanden sind und zur belastenden Vorgeschichte der Verbannung
gehören (Kreuzabnahme, Der Befreite, Die Weintraube). Als
Beckmann 1947 das verhasste Exil in Amsterdam verlässt und nach Amerika
auswandert, ist das für ihn wie eine Befreiung. Der zwangsweise Exilierte wird
zum freiwillig Emigrierten. »14 Jahre exilé / et condamné / nun wieder frei –
sehen wir was weiter kommt«, notiert er 1946, bereits ein Jahr vor seiner
Ausreise, als er einige seiner Werke nach New York schicken darf. Noch drei
Jahre nach seiner Ausreise später erinnert er sich vor Freunden an das
befreiende Gefühl der Überfahrt nach Amerika: »Sie können nicht ermessen, was
das für ein innerer Umschwung war für mich, in dies friedliche Land zu kommen,
nach den furchtbaren Zerstörungen, die ich in Europa miterleben musste.«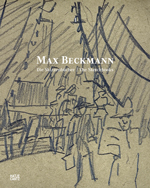 In
den USA erhält Beckmann mehrere Lehraufträge und Malklassen, er wird zu
Vorträgen eingeladen und seine Bilder hängen in den wichtigsten Museen des
Landes. Die zahlreichen Erlebnisse und Eindrücke auf seinen Reisen zu Vorträgen
und Ausstellungen verarbeitet er in unzähligen Zeichnungen und Skizzen, die er
teilweise später zu Gemälden verarbeitet. Er malt aber auch wenige
Landschaftsstudien und erneut Porträts der ihn umgebenden Menschen. Die
Städel-Ausstellung kann man daher als ideale Synthese der beiden anderen
Beckmann-Schauen interpretieren. In Frankfurt werden zur auch die drei großen
mythologisch überfrachteten Triptychen Beginning, Departure und
Argonauten präsentiert. Sie sind auch Beleg dafür, wie intensiv sich
Beckmann mit Fragen der historischen und Natur-Mythologie befasst hat. Seine
Reflektionen über eine universale und immer wiederkehrende Naturmythologie
finden sich insbesondere auch in seinen amerikanischen Bildern wieder.
In
den USA erhält Beckmann mehrere Lehraufträge und Malklassen, er wird zu
Vorträgen eingeladen und seine Bilder hängen in den wichtigsten Museen des
Landes. Die zahlreichen Erlebnisse und Eindrücke auf seinen Reisen zu Vorträgen
und Ausstellungen verarbeitet er in unzähligen Zeichnungen und Skizzen, die er
teilweise später zu Gemälden verarbeitet. Er malt aber auch wenige
Landschaftsstudien und erneut Porträts der ihn umgebenden Menschen. Die
Städel-Ausstellung kann man daher als ideale Synthese der beiden anderen
Beckmann-Schauen interpretieren. In Frankfurt werden zur auch die drei großen
mythologisch überfrachteten Triptychen Beginning, Departure und
Argonauten präsentiert. Sie sind auch Beleg dafür, wie intensiv sich
Beckmann mit Fragen der historischen und Natur-Mythologie befasst hat. Seine
Reflektionen über eine universale und immer wiederkehrende Naturmythologie
finden sich insbesondere auch in seinen amerikanischen Bildern wieder.  Exil
in Amsterdam
Exil
in Amsterdam