|
Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
| Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |
Zwischen 1994 und 2008 photographierte Lillian Birnbaum Haus und Garten von Peter Handke. Bis auf eine Ausnahme ist der Hausherr auf den Bildern abwesend, aber der Photographin gelingt es, Handke in den Dingen zu zeigen. Der Titel des Buches Portrait des Dichters in seiner Abwesenheit ist demzufolge kongenial. Peter Hamm beschreibt dieses (vermeintliche Un-)Ordnungsgefüge in seinem Vorwort zutreffend als "angerichtet". Der prächtige Bildband besticht darin, dass die Motive die Photographin gefunden haben; sie hat sie nicht "erjagt". Hierin liegt der Unterschied zwischen schnödem Abphotographieren und Kunst. Mit diesem Buch und der dokumentierten "dinghaften" Angerichtetheit kann man sich die Szenerie zu Peter Handkes neuestem Theaterstück "Die schönen Tage von Aranjuez" herbeiphantasieren. Man sieht die beiden Protagonisten (ein "Mann" und eine "Frau") in seinem Garten sitzen, sieht die Stühle und den Tisch (und auch die "hölzerne Leiter in einem Apfelbaum" - freilich ist die Leiter im Bildband an einen Balkon angelehnt) und einer der Äpfel ist dann wie selbstverständlich derjenige, den der Mann auf dem Tisch manchmal hin- und herkullern lässt (Vorsicht: eines von zwei Action-Bildern im Stück).
Zunächst kommt dieses Zwiegespräch leicht und luftig daher. Es ist still, man hört das Flügelschlagen der Schmetterlinge und die Libellenflügel knistern. Der Sturm aus Handkes ambitioniertem Partisanendrama ist einem sanften Rauschen der Bäume gewichen. Mann und Frau sitzen zum Fragen am Tisch. Scheinbar gibt eine "Vereinbarung" oder "Abmachung", die das Spiel bestimmen soll und – vor allem - das Ausfragen verbietet. Wobei es genauso sein kann, dass diese Vereinbarung erst im und durch das Gespräch entsteht (so, wie manche Erinnerung erst im Reden, im Erzählen, wiederkommt). Die beiden fragen, erzählen, reflektieren, er- und verklären und wieder-holen: Stationen aus dem Leben, Kindheitsgeborgenheiten, Selbstvergewisserungen. Die Frau erzählt von ihrer "Männerfolge" (nein, nicht von Liebhabern; wenigstens nicht nur), den "Fest[en] der Leiber", von ihren "Racheakten…aus einer Revolte" und von Trennungen (man war "zusammengeblieben, bis es kein Wir mehr gab"). Manchmal weicht der den Antworten lauschende Mann scheinbar aus ins Schauen und Anschauen. Und ins Assoziieren. Wunderbare Bilder gelingen so: die Spatzengrübchen im Sand ("für den, der zugeschaut hat"), der Schwalbenflug, eine Epipöe vom Springkraut, "die Schatten der Regentropfen auf den zwei Körpern", die Schilderung des Genusses einer (nur einer!) wilden Johannisbeere oder "der Aufwind vom Meer auf dem Plateau zusammentreffend mit dem Fallwind von den Bergen". Die Erzählung über eine Reise nach Aranjuez und das Suchen nach dem "Casa del Labrador". Der Mann wird zum "Mauerschauer", die Frau zur Suchenden, zur "Spielverderberin" (wieder scheint das "Spiel vom Fragen" auf). Handke gelingt es virtuos, eine ephemere Geborgenheit in der Welt zu evozieren. Aber die Ernüchterung folgt fast immer sofort danach. Die Ursache liegt in einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber so etwas wie Idylle, kommt sie auch noch so elegisch daher. Handke misstraut diesen "Scheingesetzen" des "geglückten Tages". Auch die "süße[n] Illusion[en]" im Zwiegespräch werden irgendwann zum Platzen gebracht (schon früh wird dieses Ende vorweggenommen); nein: sie müssen zum Platzen gebracht werden. Eben noch fast einstimmend in Piafs "Je ne regrette rien" folgt fast auf dem Fuß der Widerspruch zum "verächtlichen" "Geschmetter" und stattdessen die Referenz auf Blanche DuBois (der Figur aus "Endstation Sehnsucht") und deren Hymnus auf die "'Liebeswürdigkeit der Fremden'…'kindness auf strangers'". Ein Beispiel für ein filigranes Kippbild; die Drastik anderer Bilder ver- und zerstört zuweilen. Und plötzlich dann naht der Abschied und die äußere Stimmung verändert sich. "Die schönen Tage von Aranjuez sind nun zu Ende. Wir sind vergebens hier gewesen", so die Bilanz des Fragenden (aus Schillers "Don Carlos" zitierend). Die Stille weicht den "Hornissen" ("die aus Asien oder wo eingewanderten") und wie so oft bei Handke donnern Bombergeschwader über die Protagonisten durch die Landschaft. Dann fliegt die Libelle nicht mehr, sondern "schrammt auf dem Boden", "Hausalarmsirenen" sind zu hören, "Außenweltgeräusche", "alles in Distanz, zugleich gegenwärtig". Fernandos "Apfelzaubermärchen" weicht der "anderen Ewigkeit", die ihren Platz (wieder) einnimmt. "Man hat, was man liebt, schon von Anfang an verloren, und für allezeit, auch wenn man es nicht verloren hat", so der Mann verbittert. Und wie zum Widerspruch beginnen während dessen die behutsam entblößten Schultern der Frau "zu leuchten wie von innen heraus". Da kippt also das Bild noch einmal – mit der Möglichkeit, dass die "Blumen des Guten" doch noch gesehen werden können.
Ich stelle mir vor, wie
Jean-Marie
Staub und Danièle Huillet dieses Fragespiel als Film inszeniert hätten
(womöglich direkt in Handkes Garten). Aber das geht ja nicht mehr. Luc Bondy
wird die Uraufführung dieses Stückes für das Theater aufbereiten. Er wird
wissen, die Hervorbringungen des Schönen mit den in den Dialogen versteckten
drohenden Abgründen auszubalancieren und das große Potential dieses so
unscheinbar daherkommenden Dramas zu entwickeln. Lothar Struck |
|
|
|
|
|||
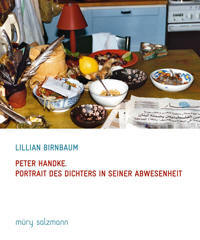
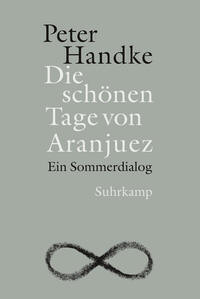
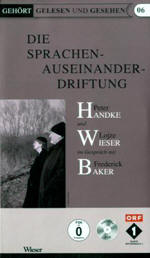 Zuweilen
erinnert der fiktive Dialog des Paares an den (freundschaftlichen)
"Schlagabtausch" zwischen Peter Handke und Lojze Wieser 2007 im jugoslawischen
(!) Karst (mit Frederick Baker; zu lesen und zu sehen ist das in
Zuweilen
erinnert der fiktive Dialog des Paares an den (freundschaftlichen)
"Schlagabtausch" zwischen Peter Handke und Lojze Wieser 2007 im jugoslawischen
(!) Karst (mit Frederick Baker; zu lesen und zu sehen ist das in