|
Andere über uns
|
Impressum |
Mediadaten
|
Anzeige |
|||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||
|
Jazz aus der Tube Bücher, CDs, DVDs & Links Schiffsmeldungen & Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Weitere Sachgebiete Tonträger, SF & Fantasy, Autoren Verlage Glanz & Elend empfiehlt: 20 Bücher mit Qualitätsgarantie Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Berserker und Verschwender Berserker und VerschwenderHonoré de Balzac Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |
Von Georg Patzer Kein Zweifel, sie sind alle meschugge. Und je mehr es sind, desto meschuggener sind sie. Allerdings haben sie nicht unbedingt schuld daran. Oder nur zum Teil. Denn wie soll man schon sein, wenn man in ein Land zusammengewürfelt wird, das einem verheißen wurde, das man aber dann mit Gewalt verteidigen muss? Wenn einem der Feind (erst der Nazi, dann der Araber) eine Identität aufzwängt, die man vielleicht gar nicht will? Dann vergisst man seine Geschichte. Oder lügt sie sich zurecht, dass sie passt. Auch die der Familie. Denn es ist ja doch zum Besten. Zum Besten des Landes, zum Besten des Sohnes. Oder nicht? Doron Rabinovici erzählt in seinem neuen Roman von einem Begräbnis zum anderen: Er beginnt mit dem Tod von Dov Zedek und endet mit dem Tod von Felix Rosen, Ethan Rosens Vater, der beste Freund von Dov. Es beginnt mit Lügen und Täuschungen und endet auch damit. Oder doch nicht? Haben sie sich etwa wirklich alle aufgelöst? Am Anfang jedenfalls sitzt Ethan Rosen im Flugzeug von Israel, wo er bei Zedeks Beerdigung war, nach Wien, wo er sich nach drei Jahren am soziologischen Institut gerade um eine Professur bewirbt. Von vielen war der mehrsprachig eloquente und streitbare Essayist und Kolumnist gebeten worden, einen Nachruf auf Dov zu schreiben. Aber er „war kein Totenredner“. Dann liest er in einer Wiener Zeitung einen Nachruf, in dem Zedek als „Streiter für Frieden und Verständigung“ gefeiert wird, als Initiator für „Fahrten jüdischer Jugendlicher nach Auschwitz“. Und dann zitiert der Autor einen Artikel in einer hebräischen Zeitung, „in der ein bekannter Intellektueller über organisierte Gruppenreisen israelischer Jugendlicher nach Auschwitz herzog. Birkenau sei kein Jugendlager und die Schornsteine der Verbrennungsöfen eigneten sich nicht für Lagerfeuerromantik. (…) Es wäre besser, mit der Jugend einige Kilometer in den Osten zu fahren, in die besetzten Gebiete, um ihnen zu zeigen, was um sie herum geschieht.“ In Wien angekommen liest er diesen Artikel noch einmal. Und jetzt macht Ethan das, was er am liebsten macht und am besten kann: Er regt sich auf. „Fünfzehn Minuten Zorn. Schreiben im Affekt. Im Geburtsland des Führers, tippte er, kämen einem die Ausführungen irgendeines ungenannt bleibenden Israeli gerade recht, wenn es darum gehe, heimatliche Selbstvergessenheit zu beschönigen. Er schrieb von der Notwendigkeit der Erinnerung und von Tendenzen, ob in Budapest oder Teheran, die Shoah zu leugnen.“ Damit wäre eigentlich der Fall erledigt, ein Streit unter Intellektuellen, der eine ist dafür, der andere dagegen: Zwei Juden – drei Meinungen, wie das Sprichwort sagt. Nur ist es hier tatsächlich so, denn der „bekannte Intellektuelle“ in der hebräischen Zeitung ist niemand anderer als Ethan selbst gewesen. Und so hat er gegen sich selbst polemisiert. Hat vehement gegen seine eigene Meinung geschrieben, sich gegen sich selbst aufgeregt. Der Fall zieht weite Kreise, vor allem, als man erfährt, dass der Verfasser Rudi Klausinger sich auch um die Stelle an der Wiener Universität beworben hat, nun sieht es auch noch so aus, als wenn Nathan einen Konkurrenten wegbeißen wollte. Die ganze Geschichte wird richtig kompliziert, als Nathan wieder nach Tel Aviv zurückfliegt, weil sein alter Vater ins Krankenhaus muss. Und dort Rudi Klausinger plötzlich auch am Krankenbett: Der unehelich Geborene ist auf der Suche nach seinem Vater gewesen und hat ihn in Felix Rosen gefunden. Und Felix? Sagt doch, er und Nathan seien tatsächlich Brüder. Dann aber taucht ein ultraorthodoxer Rabbi auf, der ausgerechnet hat, dass der Messias bereits gezeugt wurde, in einem galizischen Schtetl, aber nicht geboren, weil seine Mutter 1942 ermordet worden war. Und nun will er aus der DNA der überlebenden Verwandten, und Felix ist einer davon, den Messias künstlich herstellen: kein Jurassic, sondern ein Judaic Park. Und seine Wissenschaftler finden Sachen heraus, die der komplizierten Story noch eine weitere Drehung versetzen. Rabinovici, polnisch-rumänischer Abstammung, 1961 in Tel Aviv geborener und seit 1964 in Wien lebender Schriftsteller, Essayist und Historiker, reißt in seinem neuen Buch viele Themen an: Kann eine Meinung in Israel richtig sein und in Österreich falsch? Wie stellt man Erinnerung her, wenn die Überlebenden aussterben? Wie soll man überhaupt gedenken? Darf man lügen, um eine andere Wahrheit zu sagen? Wie geht man mit der Vergangenheit als Opfer um? Was ist mit denen, die Israeli werden wollen oder Jude? Wie Rudi, dem Nathan vorwirft: „Wie verlockend, ein Opfer sein zu dürfen, ohne je gelitten zu haben.“ Und wie leben die Juden heute miteinander und mit ihren Nachbarn, mit den anderen Völkern? Auch das ein ernstes Thema, allerdings bekommt Rabinovici hier einen ironischen Zungenschlag, allzu gern nimmt er alles auf die Schippe, wie das „Headbanging“ beim Beten: „das halbe Land wippe hin und her, als wäre der ganze Staat eine Heilanstalt.“ Israel, für das „die permanente Ausnahmesituation die einzige Normalität ist“. Und „dieser Verfolgungswahn, der in der Diaspora unsere Folklore war und nötig zum Überleben, (er) erreicht hier eine kritische Masse“. Wo findet man Ruhe und Frieden? Andernorts? „Sein Jerusalem war immer andernorts und überall zugleich“, heißt es einmal.
Rabinovicis „Andernorts“
ist eine sehr phantasievolle, realistische, witzige, rasante, satirische,
liebevolle Auseinandersetzung mit Israel und der Jüdischkeit, Shoa und
Säkularität, Lebenslügen und Weisheit, Selbsterfahrung und dem Wahnsinn der
Normalität. Er ist sicher geschrieben und komponiert, aber locker gefügt. Eine
gelungene Unterhaltung und ein ernster Zustandsbericht in einem. |
Doron Rabinovici |
||
|
|
||||

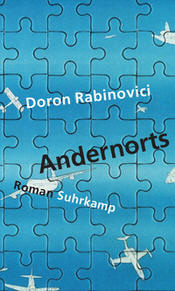 Der
Judaic Park
Der
Judaic Park