|
Jazz aus der Tube
Bücher, CDs, DVDs
&
der Link des Tages
Schiffsmeldungen
Nachrichten, Gerüchte, Ideen,
Leute & Jobs
aus der Verlagswelt, Fachpresse & Handel
Links
Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Rubriken
Belletristik -
50 Rezensionen
Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik
Quellen
Biographien, Briefe & Tagebücher
Geschichte
Epochen, Menschen, Phänomene
Politik
Theorie, Praxis & Debatten
Ideen
Philosophie & Religion
Kunst
Ausstellungen, Bild- & Fotobände
Tonträger
Hörbücher & O-Töne
SF & Fantasy
Elfen, Orcs & fremde Welten
Sprechblasen
Comics mit Niveau
Autoren
Porträts,
Jahrestage & Nachrufe
Verlage
Nachrichten, Geschichten & Klatsch
Film
Neu im Kino
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute,
Shakespeare Stücke,
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky,
Samuel Beckett
 Honoré
de Balzac Honoré
de Balzac
Berserker und Verschwender
Balzacs
Vorrede zur Menschlichen Komödie
Die
Neuausgabe seiner
»schönsten
Romane und Erzählungen«,
über eine ungewöhnliche Erregung seines
Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie
von Johannes Willms.
Leben und Werk
Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten
Romanfiguren.
Hugo von
Hofmannsthal über Balzac
»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit
Shakespeare da war.«
Literatur in
Bild & Ton
Literaturhistorische
Videodokumente von Henry Miller,
Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan
Rickman liest Shakespeares Sonett 130
Thomas Bernhard
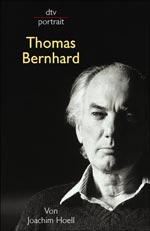 Eine
kleine Materialsammlung Eine
kleine Materialsammlung
Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen
gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen
Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen
Humor, gelt?
Hörprobe
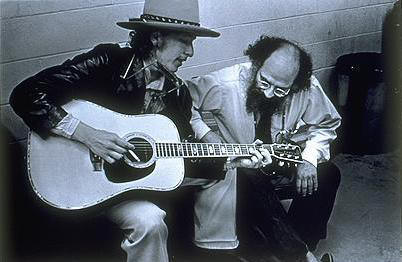
Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan
»Oh
my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/
Is called the Midwest.«
Ulrich Breth über die
Metamorphosen des großen Rätselhaften
mit 7 Songs aus der Tube
Glanz&Elend -
Die Zeitschrift
Zum 5-jährigen Bestehen
ist
ein großformatiger Broschurband
in limitierter Auflage von 1.000
Exemplaren
mit 176 Seiten, die es in sich haben:
Die menschliche
Komödie
als work in progress
 »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen«
Zu diesem Thema haben
wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás
Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter
Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den
besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.
Anzeige
 Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & Elend
Martin Brandes
Herr Wu lacht
Chinesische Geschichten
und der Unsinn des Reisens
Leseprobe
Neue Stimmen
 Die
Preisträger Die
Preisträger
Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge
reicht
von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.
Die prämierten Beiträge
Nachruf
 Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor
Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer
»Ich glaube nicht an Psychologie,
ich glaube an gute Züge.«
Wir empfehlen:
kino-zeit
Das
Online-Magazin für
Kino & Film
Mit Film-Archiv, einem bundesweiten
Kino-Finder u.v.m.
www.kino-zeit.de




Andere
Seiten
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«
Riesensexmaschine
Nicht, was Sie denken?!
texxxt.de
Community für erotische Geschichten
Wen's interessiert
Rainald Goetz-Blog

|
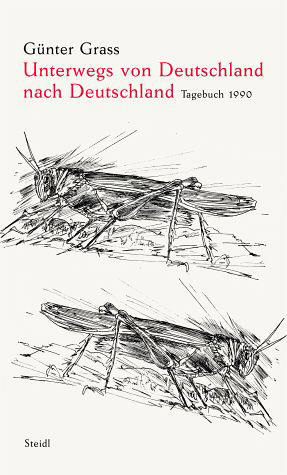 Das
Tagebuch als Zwischenlager Das
Tagebuch als Zwischenlager
Lothar Struck über das
Tagebuch 1990 von Günter Grass »Unterwegs von Deutschland nach Deutschland«
Man
erfährt am Ende des Buches mehr darüber, warum das Tagebuch plötzlich
auf Vortritt besteht: Es ging darum, bisher unbekannten Schreibhemmungen
zu begegnen. Das Tagebuch als eine Art Selbstvergewisserungsinstrument; ein
Zwischenlager. Der aufmerksame Leser wundert sich anfangs über Art und Zahl der
(unterschiedlichsten) Entwürfe zum Projekt der "Unkenrufe". Ständig werden
Erzählpersonen, -perspektiven, -zeiten, -motive erwogen und wieder verworfen und
man ist überrascht irgendwann unter einem Datum im Sommer zu lesen, dass wohl im
Laufe des Jahre noch der erste Satz folgt (es geht aber dann schneller und
verblüffend reibungslos, was nur noch wie nebenbei berichtet wird).
Warum diese Schreibhemmungen? Sind es die hektischen und eruptiven Zeitläufte,
die Grass' Selbstsicherheit, die politischen Koordinaten für einen Moment aus
der Balance bringen? Einübung einer Disziplin für den eher unstet werdenden,
sich politisch (zu stark?) gebenden Schreiber? Die "schöne Endzeit" (Kerstin
Decker) ist im Januar 1990, als Grass pünktlich am 1. beginnt, schon fast
vorbei.
Reisen, kochen,
schreiben, zeichnen
Der Leser erfährt (wie häufig in solchen Tagebüchern) einiges über das
Privatleben des Autors (wenn auch nicht alles, etwa wenn fast auf der letzten
Seite fast beiläufig von der Überwindung der Ehekrise die Rede ist, die vorher
keinerlei Erwähnung würdig schien). Grass reist enorm viel (der Titel ist
durchaus präzise) und nicht nur zwischen seinen diversen Feriendomizilen; es
gibt mehrere Reisen in die DDR, Tschechoslowakei, ein Kongress in Norwegen - und
natürlich Polen (zu seinen Kaschuben). Ansonsten kocht Grass
deftig-rustikal (nichts ist vor ihm sicher; jeder Pilz, jeder Fisch, jedes
Wildtier wird, wenn möglich, gebraten, geschmort oder gekocht) und man fragt
sich, warum er eigentlich so verblüffend selten Magenprobleme hat.
Vor allem erweist er sich aber als berserkerhafter Zeichner und Graphiker. Auch
hier ist kein Motiv vor ihm sicher: ein abgegessener Fisch, ein gehäutetes
Kaninchen, eine in Alkohol eingelegte Heuschrecke aber auch der geschenkte
Kaktus, der Ausblick aus einem Hotelzimmer oder Grossformatiges für Kirchen (!).
Auf den ersten siebzig und den letzten sechzig Seiten gibt es einige der
Zeichnungen. Diese und der gelegentlich ans 19. Jahrhundert erinnernde
Sprachduktus von Grass entrücken dieses Tagebuch manchmal aus der Zeit, etwa
dann, wenn er aus Tintenfischen Tinte gewinnt. Leider sind diese kontemplativen
Momente zu selten.
Die "Zeit" hat neulich
Auszüge publiziert, die suggerierten, die Tagebücher bestünden fast
ausschliesslich aus Äusserungen zum für Grass per se gescheiterten
Einigungsprozess (den er ja so, wie er geschah, dezidiert ablehnt und mit
allerlei Invektiven versieht). Das ist wie schon erwähnt glücklicherweise nicht
der Fall. Werkbiographen und Germanisten bekommen einiges zu tun; im Herbst (das
Projekt "Unkenrufe" ist immer noch in seltsamer Schwebe) entwickelt Grass
plötzlich aus seinem Kopf ein Exzerpt für einen Roman (den er für 1997 fertig
sieht). Ein Projekt, welches eine grosse Recherchearbeit erfordert, sich ihm
sprudelnd in groben Zügen zeigt, ja geradezu epiphanisch erscheint. Es sind
Reflexionen und Gedankensplitter über Theodor Fontane, der in die Gegenwart
versetzt wird und eine Figur des Autors Hans Joachim Schädlich an die Seite
gestellt bekommt ("Tallhover"). Der Arbeitstitel lautet "Die Treuhand" (Grass
will, obwohl er die Treuhand und deren Stil verabscheut, einen Termin mit
Rohwedder vereinbaren, um mehr zu erfahren) – später wird daraus "Ein weites
Feld" – das Buch, das Reich-Ranicki auf dem Cover des "Spiegel" zerreissen wird.
Der Leser mit dem Wissen
von heute erkennt, wie sehr Grass' Augstein-Rezeption (insbesondere dessen
Bismarck-Bild) in dieses dann 1995 erscheinende Buch eingeflossen ist. Grass ist
geradezu unflätig Augstein gegenüber, der zum Nationalisten verkomm[e],
betitelt ihn als kleinwüchsigen wie grössenwahnsinnigen Potentaten und
dann als liebenswerte[n] Narr[en], der Sekretärinnen tätscheln muß, die
Korruption in aller Welt mit dem "Spiegel" bekämpft, aber die Korruption in
seinem Haus…duldet und sich in deutschnationalem Starrsinn gefällt, was ihn
nicht davon abhält, mit ihm in der Öffentlichkeit zu diskutieren und über
Hellmuth Karasek (Augstein: "Karasek ist gescheit und korrupt" -
vermutlich ist beides falsch) herzuziehen.
Verlust des politischen
Koordinatensystems
Weiterhin bietet Grass seine Aufsätze und politischen Kommentare zur Einheit
jedoch zunächst dem "Spiegel" an. Als dieser dann einen Text von ihm nur
zensiert (d. h. um ein Kapitel gekürzt) übernehmen will, ist kurz die "Zeit"
die erste Anlaufstelle, bis Ulrich Greiner eine, wie Grass meint Hexenjagd
gegen Christa Wolf eröffnet (und das "Spiegel"-Feuilleton nachzieht). Danach
weicht er auf "Süddeutsche" oder "FR" aus (mit eher mässigem Erfolg). Dennoch
muss Grass' Präsenz insbesondere im Fernsehen mindestens im ersten halben Jahr
1990 sehr gross gewesen sein – einmal wird ein Termin für eine "Kennzeichen
D"-Sendung (ZDF) abgesagt, weil er schon anderenorts so oft zu sehen war.
Als zeitgeschichtliches
Dokument ist das Tagebuch eher von marginalem Interesse. Aber es gibt
erstaunliche Einblicke in das politisch-strategische Denken von Grass, der
immerhin als einer der führenden Intellektuellen gilt (auch danach noch? -
könnte man besorgt fragen). Und es zeigt, dass Grass' Verzweiflung (wie
berechtigt sie im Einzelfall auch immer sei) Auswirkungen auf sein literarisches
Schaffen zu dieser Zeit hat.
Anfangs stemmt sich Grass mit teilweise törichter Rhetorik gegen jegliche
politische Lösung der durch den Mauerfall entstandenen Situation und befürwortet
eine autonome DDR. Verräterisch die Bemerkung gleich zu Beginn: Will
versuchen,… das angebliche Recht auf deutsche Einheit im Sinne von
wieder-vereinigter Staatlichkeit an Auschwitz scheitern zu lassen. Einige
Äusserungen Grass' sind wahrlich von imposanter (politischer) Dummheit.
In dieser fast paranoiden Phase beginnt er selbst an Willy Brandt zu zweifeln.
Es überkommt ihn eine Beunruhigung, wenn dieser Nuancen anders betont,
als Grass meint, dass Brandt zu sprechen habe. In einer Diskussion mit ihm muss
er grundsätzlich widersprechen, was ihm nicht leicht fiel. Ein "Spiegel"-Interview
Brandts verwirrt Grass, weil dieser dort abwechselnd von Föderation und
Konförderation spricht und einmal hätte er sich mehr Deutlichkeit
gewünscht. Man fragt sich, ob Grass die Intention von Brandts (und Bahrs)
Ostpolitik, das Prinzip "Wandel durch Annäherung", überhaupt jemals verstanden
hat. Wie ein Geigerzähler knattert Grass sein Genörgel und Gejammer
insbesondere in den ersten Monaten gegenüber allen und allem, was ihm als
nationalem Stumpfsinn dünkt. Wer nicht (fast) bedingungslos für ihn ist,
ist gegen ihn.
Als Alibinörgler
geduldet – aber machtlos
Keine Plattitüde wird ausgelassen, so lange sie in sein Konzept passt und so
siedeln die Themen Auschwitz, deutsche Frage, Waldsterben nicht weit
voneinander. Wie rasend verliert Grass kurz seine politischen Koordinaten,
vermischt die politischen und ökonomischen Implikationen und ist dagegen, weil
man eben dagegen zu sein hat (oder weil alle anderen dafür sind – so klar ist
das nicht). Dabei sind seine ökonomischen Kassandra-Rufe (auch aus heutiger
Sicht) durchaus berechtigt und haben sich teilweise als zutreffend erwiesen.
Indem diese jedoch mit wuchtiger politischer Rhetorik vermengt (Anschluss;
Kohl im Sportpalast-Stil) und zu einem undefinierbaren Brei
zusammengerührt werden, macht Grass es seinen Gegnern leicht, das Gericht als
ungeniessbar stehen zu lassen.
Ständig kokettiert er im
Laufe des Jahres mit seinem Austritt aus der SPD, schreibt Briefe, an Oskar
(den dieser erst nach zweieinhalb Monaten mit einem Anruf beantwortet), an
Engholm, gibt ungefragt Ratschläge und merkt nicht, wie er in vom Strudel der
Ereignisse an den Rand gespült wird. Und dann noch an den Rand der SPD, die im
Osten zur 22%-Partei im März 1990 wurde und "gesamtdeutsch" mit Lafontaine auf
33,5% kam. Grass als doppelte Randexistenz. Früh spürt er, dass Lafontaine der
falsche Kandidat ist, weil er nur ein "Nein" bietet ohne klares
Gegenkonzept oder – warum nicht? – Vision und er überlegt, ob er mit ihm
in den toten Wald geht. Nach dem Attentat hofft er kurz, er möge aufgeben;
im Laufe des Wahlkampfs bleibt Grass' Respekt zu Oskar, mehr nicht.
Als sich Grass besinnt entwirft er Gegenkonzepte, bleibt dabei aber immer hübsch
weit von jeder nur möglichen realistischen Verwirklichung, um nicht daran
gemessen zu werden. Er entwickelt ein Sieben-Punkte-Programm, vertraut dem
Tagebuch seine Kompromisslinie an - aber wer will das hören. Grass sieht eine
Hässlichkeit in dieser Vereinigung; die DDR werde fremdbestimmt
posaunt er heraus. Er träumt noch von einem "Bund deutscher Länder" als
Engholm ihn nach der gescheiterten Bundestagswahl Weihnachten 1990 besucht
(Lafontaine ist abgetaucht [es sollte nicht das letzte Mal sein]) und es nicht
manchmal nicht ganz klar, ob es sich Grass im Vorgefühl des Scheiterns
der Einheit und ob der Vergeblichkeit seiner Anstrengungen nicht auch arg
bequem macht.
Am schlimmsten muss es
sein in diesen Momenten nur als Alibibedenkenträger zu fungieren, der
pflichtschuldigst in den Medien abgedruckt und gesendet wird und danach gehen
darf. Ein geduldetes Feigenblatt, auch für die SPD, die rat- und konzeptlos ist;
Brandt entrückt, Schmidt mit einer Breitseite gegen den Spitzenkandidaten kurz
vor der Wahl (das kennt man in der SPD also), Vogel zwischendrin und Engholm
(der potentielle Nachfolger) - auch er in Grass' Augen ungeeignet (da hatte er
Recht) und viel zu schnell in den üblichen Machtzynismus verfallen. Und
mittendrin der sich durch Gartenarbeit ablenkende, Bäume pflanzende (Pflanzwut),
kochende, seine Kinder besuchende, Bücher lesende (Rushdies "Satanische Verse" [gegen
Ende reißerisch]; Rilke; sonst eher wenig), vor allem Zeichnende, dessen
Mahnungen, Aufschreie, Appelle nicht gehört werden, als hätte sich "seine" SPD
vor den Sirenengesängen des Dichters die Ohren verstopft.
"Schwarzseher der Nation" – welch' eine Kränkung
Die Demütigung
sitzt wohl tief und wenn er das Wort Depression gebraucht, dann glaubt
man ihm. Er, der weiland so gefragte und gewünschte Intellektuelle, wird einfach
ignoriert, was vor allem daran liegt, dass die SPD der Kohlwalze, die in fast
mechanischer Präzision vorgeht, nichts entgegenzusetzen hat. Verbitterung?
Wahrscheinlich, aber Grass setzt auch hier im Tagebuch oft genug eine Maske auf
(oder er hat es bereinigt – wer weiss?). Man merkt: Dieser Mann ist nie privat
wenn er schreibt; immer Schriftsteller, Textverwerter, Institution; immer
öffentlich. Und immer Verfremder, immer auch ein Teil Fiktion, und natürlich,
auch Posierender. Immer scheint er um seine Literarizität bemüht, auch noch wenn
er nur von banalen Dingen spricht (die leider zu häufig banal bleiben). In der
aufgebauschten Affäre im Jahr 2006 um seine Zugehörigkeit zu einer
Waffen-SS-Einheit stellte sich Grass ein bisschen dumm und meinte, er könne doch
nichts dafür, wenn andere in ihm eine moralische Instanz gesehen hätten und das
hätte er so nicht sein wollen. Das Tagebuch widerlegt das eindeutig. Jede Faser
schreit nach Anerkennung, giert nach Aufnahme in die jeweilige Diskussionsrunde
- freilich aus dem gemütlichen Sessel des Intellektuellen heraus (in die
Politik? – der Gedanke kommt ihm nie; Havel desavouiert er bereits als von der
Macht infiltriert).
Nur Antje Vollmer hört ihm zu; lange Telefonate mit ihr, Grass überlegt die
Grünen zu wählen, besucht eine Versammlung, hält eine Rede und bekommt dann
dieses basisdemokratische Gequatsche mit. Er wendet sich wieder ab und
beschliesst irgendwann noch mal SPD zu wählen, denn soviel Minderheit will er
dann doch nicht sein.
Kaum jemand in diesem Buch besteht vor Grass' Urteil. Das Feuilleton nicht –
Greiner und Schirrmacher sind für ihn richtende Kulturfunktionäre - und
auch (auch?) Schriftstellerkollegen nicht. Er hadert mit Jurek Becker, als
dieser im "Literarischen Quartett" Reich-Ranicki nicht entscheiden genug
widerspricht. Und als Erich Loest, den er am Anfang hoffiert, Grass plötzlich
Schwarzseher der Nation nennt, bemerkt Grass resignierend, dass, sobald
das Gespräch öffentlich wird, die Kollegen in Profilsucht verfallen.
Der unpolitische Rühmkorf bleibt noch; die sich zergrübelnde Christa
Wolf, Hein. Grass will Christa Wolf beistehen, will wieder helfen und dabei
gehört werden (in dem er gleich wieder eine neues Pamphlet schreibt Beim
Strickedrehen), aber wieder verhallt sein Hilfeangebot und er stürzt sich
dann in Gartenarbeit oder Zeichnungen und überlegt, wie er den Absprung von
Luchterhand einfädeln kann, diesen maulfaule[n] Haufen voll mit
Literaturbeamte[n].
Daumen drücken für
Klinsmann
Seine Idyllisierung der DDR hat obszöne und komische Seiten, etwa wenn er
von diesem verletzte[n], traurige[n], graue[n] Land spricht. Mal mokiert
er sich über die beklemmend lockere Grenzkontrolle (deutsch-deutsch), mal
stört er sich daran (deutsch-polnisch). Seine Abneigung zur
Großbundesrepublik, die Großpolitiker in ihrem Bonner Befehlston
(zum Kotzen!) und die Westdeutschen, die in die DDR kommen, sind für ihn
Kolonialbeamte. Währenddessen kauft er für billige Ostmark kubanische
Zigarren (so lange es noch geht).
Und wie beinahe peinlich seine Reisen in die DDR und sein Anbiedern an die
Angeschmierten, wie er sie nennt, aber sich selbst meint. Für ihn ist Modrow
eine melancholische Figur (menschlich, wissend, leidensfähig, beinahe
anrührend); Gysi mag er nicht, daher unterschätzt er ihn. Im Januar noch
siegessicher für die SPD (das erinnert fatal daran, als die SPD 1949 auch
dachte, die Wahlen zu gewinnen), bröckelt diese Zuversicht von Tag zu Tag. Aber
die Dimension der Niederlage bei den Volkskammerwahlen hatte selbst er nicht
erwartet und er fügt sich schlecht darin. Als ein Mann auf der Strasse ihm sagt,
die Leute hätten doch diese verkohlt[e] Einheit gewollt, meint er, jetzt
würde schon wieder der ostdeutsche[n] Bevölkerung die Rolle des
Versagers, Verlierers zufallen. Demokratie ist für Grass manchmal schwer
auszuhalten (Wahlschwindel) und er glaubt es einfach nicht, dass man
einen anderen als seinen Standpunkt haben kann.
Trauer
bei der letzten Zugfahrt durch die DDR - natürlich wie immer erster Klasse.
Obwohl er das rechte Gewaltpotential schon wahrnimmt. Und obwohl er einmal
Lafontaine fast anfleht Erbarmen zu zeigen – für die Menschen. Ja, es ist
wohl schlimm, die liebgewonnene Puppenstubenperspektive aufgeben zu müssen. Und
dann, wenn nach Polen weiterreist, sieht er plötzlich die maroden Gebäude,
beklagt das Unvermögen der Leute und ärgert sich (dann plötzlich ganz
"Deutscher" werdend).
Manchmal gelingen (unfreiwillig? gewollt?) Bilder von Kraft und hintergründiger
Symbolik. Grass geht in die Brombeeren (wer jemals Brombeeren geerntet
hat, weiss, was das bedeutet). Oder wenn er im Herbst das Fallobst mit grosser
Vitalität einsammelt – und dem Leser kommt es vor, als sammle er zugleich seine
Deutschlandpolitik mit ein (und vermostet sie gleich mit). Oder wenn er in
Gdansk Weite, Kindheit, sich wiederholendes Grün entdeckt und ins
Schwärmen gerät. Seltene Momente vom Glück eines Getriebenen; man mag ihn dann
sofort.
Aber dieser Grass'sche
Selbsthass. Er wolle lieber Zigeuner sein als Deutscher krakeelt er. Bei
der Fussball-WM (diese Ersatzkriege) drückt er den Tschechen die
Daumen, aber findet Klinsmann und Littbarski toll und hofft, dass sie keine
gelbe Karte bekommen (er nennt das Rückfälle). Der Wunsch, Deutschland
möge gegen England ausscheiden – und dann das Sich-Ertappen, den Deutschen beim
Elfmeterschiessen die Daumen zu drücken. Wie komfortabel es sich doch dieser
Position leben lässt: (Scheinbar) auf der Seite des anderen – und doch Freude
beim deutschen Sieg. Man gewinnt immer. Eigen-Seelenmassage (oder doch eher ein
kleiner Selbstbetrug?) und Nörgelattitüde.
Die Mauer fällt vom
Osten aus
Grass beklagt diese dumpfe Bewunderung der Westdeutschen, die ihm zum
Beispiel in der Tschechoslowakei begegnet, diesem, wie er konstatiert,
glücklichen, armen Land - weil es keinen reichen Bruder hat (dass die
Tschechen eine andere Meinung haben, interessiert ihn nicht). Entfremdung von
Havel, der schlecht zuhören kann. Nebenbei Grass' schier pathologische Akribie:
sich erinnernd, Havel 1967 eine Hasenpastete geschenkt zu haben.
Aber hat Grass nicht mit seinen Zweifeln an Art und Geschwindigkeit dieses
Vereinigungsprozesses Recht behalten? Vor allem, was die Ökonomie angeht. Und
natürlich die Befürchtung, Deutschland könnte wieder auftrumpfen (mit Berlin als
Hauptstadt). Einiges wirkt heute fast niedlich; anderes real. Wenn Grass von der
inneren Einheit spricht, die sich so nicht einstellen kann, werden einige
ihm zustimmen. Gefühlte Zustimmung. Fakten waren (und sind) Grass' Sache nicht.
Die Vorhersage, die innere Einheit werden nicht gelingen, ist zunächst einmal so
allgemein, dass sie immer auch irgendwie stimmt. So wie das vom Schnäppchen
DDR. Dass der Mauerfall von den Ostdeutschen ertrotzt und erkämpft wurde – Grass
berücksichtigt das nirgendwo. Er glaubt, Kohls Politik treibe gut ausgebildete,
junge Menschen von der DDR in den Westen. Nur einmal konzidiert er, dass dieser
Vorgang seit November/Dezember 1989 bereits im Gang ist. Die weltpolitischen
Implikationen, die Fragilität Gorbatschows – kein Thema in diesen Betrachtungen.
Der aufkommende Golfkrieg wird als Bedrohung empfunden und Grass philosophiert
darüber, ob die USA nicht ebenfalls vom Wettrüsten geschwächt seien, aber
dass Bush versucht eine weltweite Koalition unter dem Dach den UN gegen den Irak
zusammenzustellen – Fehlanzeige. Die Nationalismen in Osteuropa, das
auseinanderbrechende Jugoslawien – Grass sieht nur den Nationalismus der Balten
und der Serben; kein Wort von den Kroaten und Slowenen. Selektive Wahrnehmung.
Stattdessen viel Lamento über das Ozonloch und den Klimawandel – der Flieder
blüht jetzt im Mai. Aber wann sonst?
Und es steht zu
befürchten, dass die beiden Heuschrecken auf dem Buchumschlag (eine von Ost nach
West, die andere von West nach Ost) auch schon wieder ihre Symbolik haben. Grass
gibt keine Ruhe. Jene heitere Zuversicht die weiss, dass es schlimm
ausgehen wird, nervt enorm. Sie hat etwas von der Persistenz der
"Prophezeiung" des eigenen Todes.
Aber was wäre nur ohne ihn? Lothar Struck
Die kursiv gedruckten
Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
|
Günter Grass
Unterwegs von Deutschland nach Deutschland
Tagebuch 1990
Steidl Verlag,
Göttingen 2008
Gebunden, 258 Seiten,
20,00 EUR
ISBN-13
9783865218810
|
 Honoré
de Balzac
Honoré
de Balzac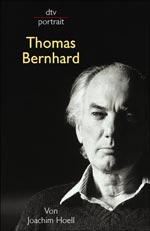 Eine
kleine Materialsammlung
Eine
kleine Materialsammlung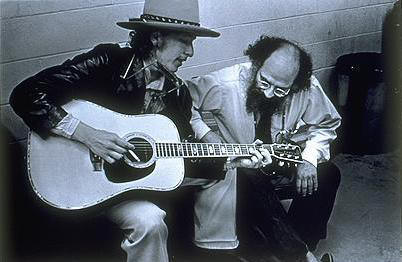
 »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen«
»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen« Edition
Glanz & Elend
Edition
Glanz & Elend Die
Preisträger
Die
Preisträger

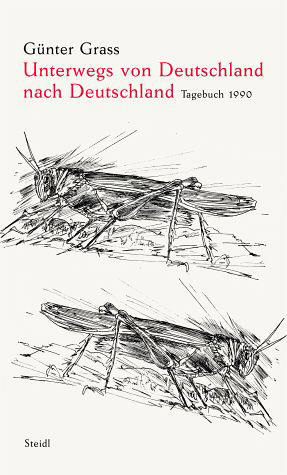 Das
Tagebuch als Zwischenlager
Das
Tagebuch als Zwischenlager